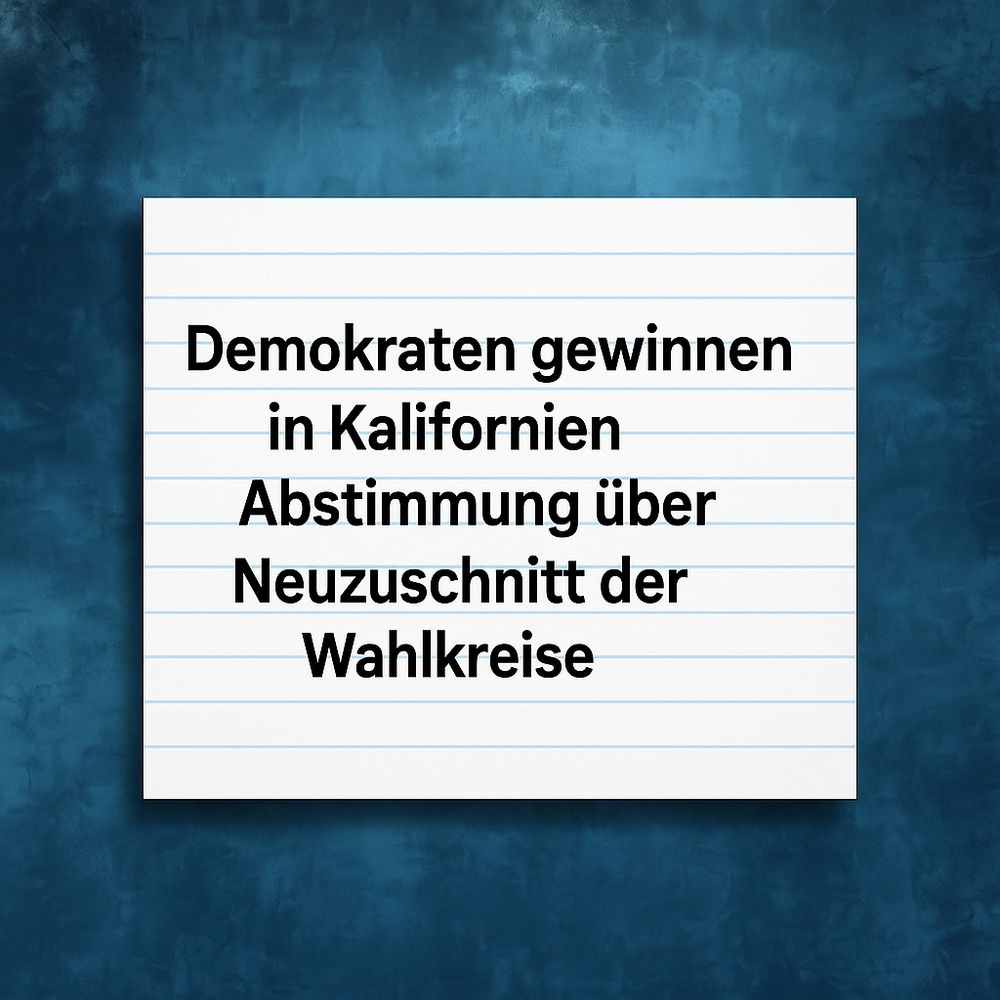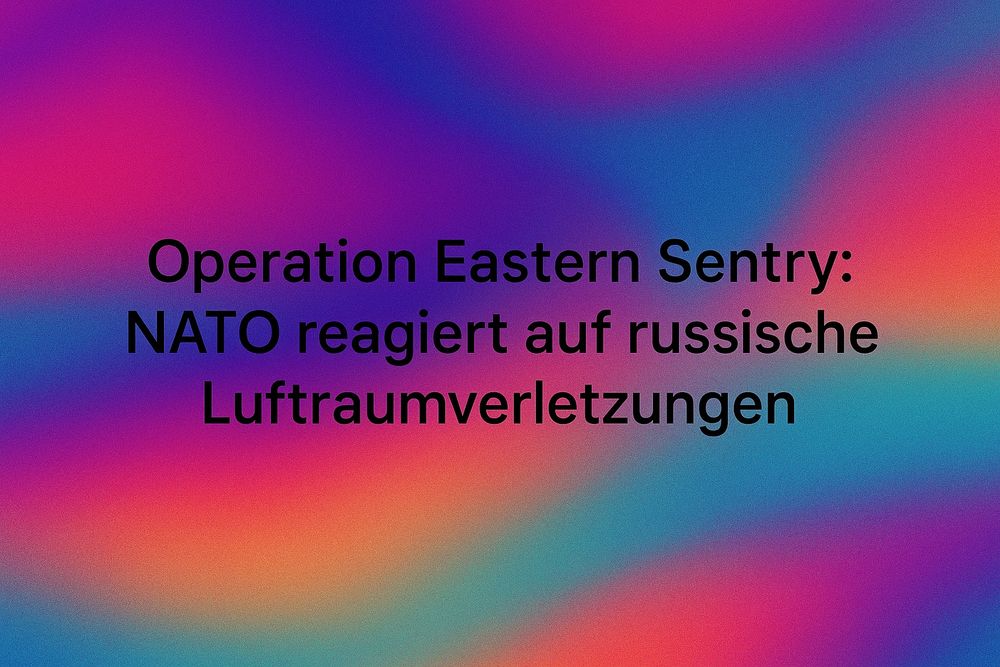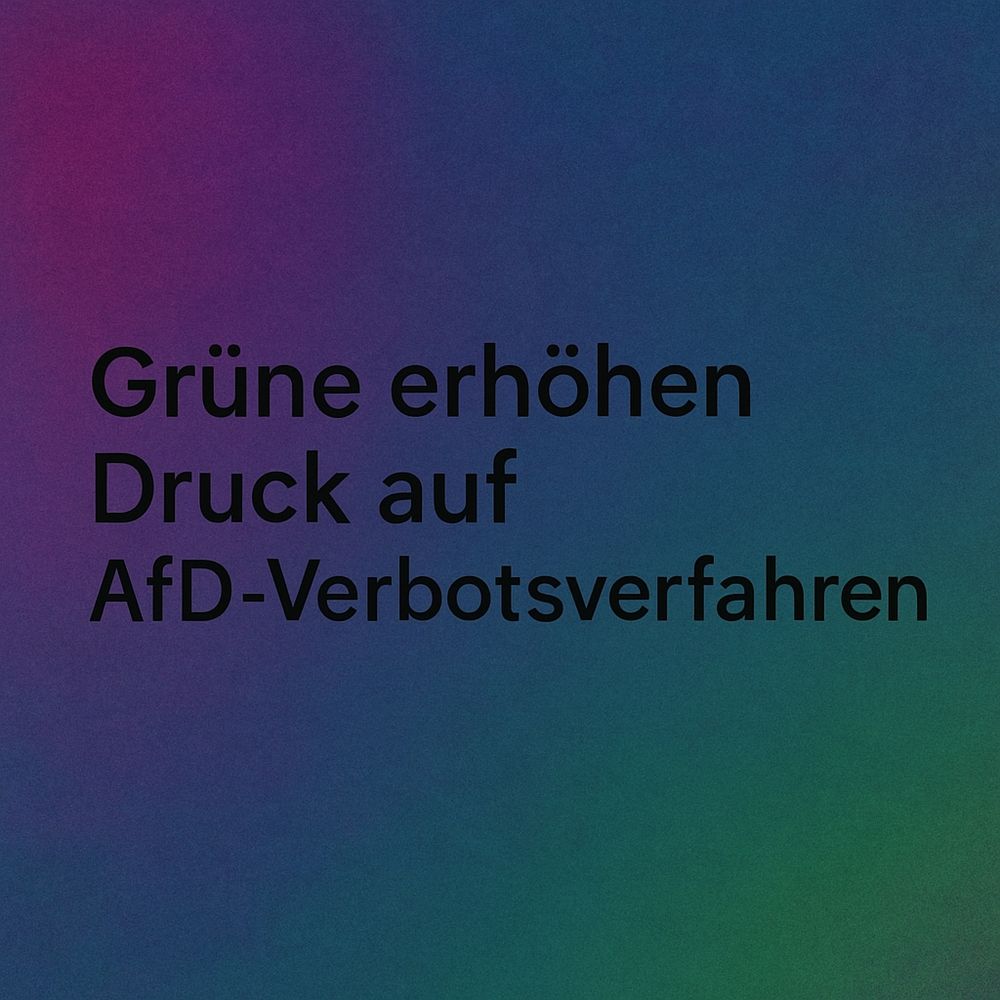Grüne Lunge der Erde: Der Amazonas steht unter hoher ökologischer Belastung
Nach Angaben des deutschen Umweltministeriums sind die Folgen des Waldverlusts auch in Europa messbar, da die Pflanzen große Mengen CO₂ aufnehmen und regionale sowie internationale Wettersysteme stabilisieren.
Eine der Ursachen der Zerstörung ist der fortschreitende Straßenbau. Neue Verkehrswege öffnen den Wald für illegale Holzfäller und machen bisher unberührte Regionen zugänglich. Darauf folgt meist Abholzung. Wissenschaftler schätzen, dass etwa 90 Prozent der Rodungen im brasilianischen Amazonasgebiet illegal erfolgen.
Seit 1985 bis heute gingen rund 52 Millionen Hektar Natur in Brasilien verloren, mehr als die Fläche Spaniens. Besonders die Ausweitung der Nutztierhaltung treibt die Rodung voran: Die Weideflächen wuchsen von 12,3 auf 56,1 Millionen Hektar.
Zusätzlich belasten Gold- und Erzabbau im Amazonasgebiet das Ökosystem. Bei der Goldgewinnung wird giftiges Quecksilber eingesetzt, das Wasser, Fische und Menschen vor Ort belastet und schwere gesundheitliche Schäden verursacht. Besonders betroffen sind Nerven- und Immunsystem. Wie das World Resources Institute berichtet, hat der illegale Goldabbau einen jährlichen Handelswert von über 30 Milliarden US-Dollar.
Insgesamt sind rund 17 Prozent der ursprünglichen Amazonas-Waldfläche zerstört. Klimaforscher warnen vor einem Kipppunkt der Erderwärmung, ab dem sich der Regenwald in eine Savanne verwandeln könnte. Wird dieser Kipppunkt überschritten, ist der Prozess irreversibel. Ein Überschreiten der 1,5-Grad-Celsius-Marke würde diese Entwicklung zusätzlich beschleunigen. Brasiliens Präsident Lula kündigt an, die Entwaldung bis 2030 stoppen zu wollen. Auf der Weltklimakonferenz 2025 fordert Brasilien internationale Unterstützung, da der Regenwald globale Klimadienstleistungen erbringt.
17. November 2025 – Der Amazonas-Regenwald wird oft als die grüne Lunge der Erde bezeichnet. Doch dieses lebenswichtige Ökosystem steht zunehmend unter enormer Belastung. Illegale Abholzung, die Expansion landwirtschaftlicher Weideflächen, Brände und Rohstoffabbau haben dem Wald erheblich geschadet.
19.11.2025 19:25 — 👍 9 🔁 0 💬 0 📌 0

Trump droht ihr: Langjährige Trump-Unterstützerin Greene fürchtet nun um ihre Sicherheit
Auf der Plattform X erklärt Marjorie Taylor Greene, sie werde seit Trumps öffentlichem verbalen Angriff massiv bedroht. Private Sicherheitsfirmen aus den USA hätten sie bereits kontaktiert und vor möglichen Gefahren gewarnt. Greene, die den 14. Wahlbezirk im Bundesstaat Georgia im US-Repräsentantenhaus vertritt, führt die Bedrohungen darauf zurück, dass Donald Trump öffentlich Stimmung gegen sie mache. Insbesondere als Frau nehme sie Drohungen von Männern ernst. Sie bezeichnet Trump zugleich als „mächtigsten Mann der Welt“.
Trump hatte Greene zuvor die politische Unterstützung entzogen und sie öffentlich als „zitternde Irre“, „Verräterin“ und „weit nach links abgerückt“ diffamiert. Greene distanzierte sich immer deutlicher von der politischen Linie des US-Präsidenten und löste sich schließlich vollständig von ihrer bisherigen Loyalität gegenüber Donald Trump und seiner Politik.
Donald Trump bestreitet weiterhin engere Verbindungen zu Jeffrey Epstein. Doch die jüngsten veröffentlichten Dokumente und E-Mails deuten laut US-Medien auf eine deutlich größere Nähe zwischen beiden Männern hin. Zudem existieren zahlreiche Videos und Fotos, die Trump und Epstein gemeinsam zeigen. Vor diesem Hintergrund drängt Greene besonders lautstark auf Transparenz und unterstützte zuletzt sogar einen Vorstoß der oppositionellen Demokraten im US-Repräsentantenhaus zur vollständigen Freigabe aller Fallakten.
Jeffrey Epstein starb im August 2019 in einem New Yorker Gefängnis, während er auf einen weiteren Prozess wegen sexuellen Missbrauchs wartete. Offiziell wurde sein Tod als Suizid eingestuft. Ermittlungen zufolge hatte er über mehrere Jahre hinweg minderjährige Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht und an einflussreiche Persönlichkeiten vermittelt.
16. November 2025 – Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene aus dem US-Bundesstaat Georgia berichtet von massiven Drohungen gegen ihre Person. Auslöser ist ein öffentlich ausgetragener Streit mit Präsident Donald Trump über die vollständige Veröffentlichung aller Epstein-Akten.
17.11.2025 10:52 — 👍 10 🔁 4 💬 2 📌 0

EU leitet Wettbewerbsverfahren gegen Red Bull wegen möglichem Marktmissbrauch ein
Im Raum steht der Verdacht, dass Red Bull seine marktbeherrschende Stellung ausgenutzt haben könnte, um Konkurrenten gezielt zu benachteiligen. Sollte sich dies bestätigen, drohen dem Konzern empfindliche Strafen nach EU-Wettbewerbsrecht.
Nach bisherigen Erkenntnissen soll Red Bull insbesondere in den Niederlanden versucht haben, eine Strategie umzusetzen, die sich vor allem gegen den „Hauptkonkurrenten“ Monster im Energy-Drink-Markt richtet. Am Energy-Drink-Hersteller Monster ist auch der US-Konzern Coca-Cola unternehmerisch beteiligt. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt auf dem Segment der Energy-Drinks mit einem Füllvolumen von 250 Millilitern und mehr, also darunter auch die klassische 250-Milliliter-Dose, mit der Red Bull bekannt geworden ist.
Die Kommission wirft Red Bull vor, versucht zu haben, den Verkauf von Konkurrenzprodukten in Supermärkten und Tankstellen zu behindern. Dies soll entweder durch direkte Maßnahmen zum Stopp des Verkaufs geschehen sein oder durch subtile Formen der Benachteiligung wie schlechtere Produktplatzierungen im Verkaufsraum. Zudem besteht der Verdacht, dass Red Bull Händlern „monetäre und nicht-monetäre Anreize“ angeboten hat, um Alternativprodukte zu verdrängen. Solche Praktiken könnten eine unzulässige Einschränkung des Wettbewerbs sein.
Bereits im März 2023 hatten EU-Wettbewerbshüter Geschäftsräume von Red Bull in mehreren EU-Ländern durchsucht. Der Konzern erklärte damals seine Bereitschaft, mit den Behörden „in allen Belangen“ zusammenzuarbeiten. Die aktuellen Untersuchungen sollen nun klären, ob das österreichische Unternehmen seine marktbeherrschende Stellung tatsächlich missbraucht und damit gegen EU-Wettbewerbsregeln verstoßen hat.
Bei bestätigten Verstößen gegen EU-Recht drohen Red Bull hohe Geldstrafen sowie verbindliche Auflagen, um fairen Wettbewerb wiederherzustellen.
13. November 2025 – Die Europäische Kommission hat ein umfassendes Wettbewerbsverfahren gegen den Energy-Drink-Hersteller Red Bull eingeleitet. Grund sind Hinweise auf möglichen Marktmissbrauch in mehreren EU-Mitgliedstaaten. #RedBull #EnergyDrinks #EUKommission #EUWettbewerbsrecht #EnergyDrinkMarkt
15.11.2025 15:52 — 👍 11 🔁 1 💬 0 📌 0

Nach Angaben der ukrainischen Regierung sowie von Präsident Selenskyj persönlich sollen die Drohnenflüge entlang der ukrainisch-ungarischen Grenze registriert worden sein und „wahrscheinlich aus Ungarn stammen“. Diese Vorfälle verschärfen den ohnehin angespannten Ton zwischen den Nachbarstaaten.
Ungarns Außenminister Péter Szijjártó wies die Anschuldigungen zurück und reagierte mit Spott. Auf der Plattform X schrieb er, Selenskyj verliere wegen seiner „anti-ungarischen Obsession“ den Verstand und beginne, „Dinge zu sehen, die gar nicht existieren“. Damit wählte Szijjártó einen bewusst provokativen Ton gegenüber der ukrainischen Regierung.
Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha konterte umgehend und warf der ungarischen Regierung „Heuchelei“ und „moralische Verkommenheit“ vor. Er beschuldigte Budapest, sowohl offen als auch verdeckt gegen die Ukraine und Europa zu agieren, und bezeichnete Ungarn als „Handlanger des Kremls“. Diese Aussagen unterstreichen Kiews tiefes Misstrauen gegenüber der ungarischen Regierung und ihrer prorussischen Haltung.
Die Staatsregierung in Kiew kritisiert seit Langem Ungarns enge Beziehungen zu Russland. Die Ukraine kämpft seit über dreieinhalb Jahren gegen den russischen Angriffskrieg und sieht in Ungarns Kurs eine Schwächung der europäischen Solidarität. Ungarns ablehnende Haltung gegenüber EU-Sanktionen gegen Russland und seine Energiekooperation mit Moskau sorgen immer wieder für Spannungen.
Bereits im August 2025 war es zu Spannungen gekommen, als die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die russische Erdölpipeline „Druschba“ angriff, die auch Ungarn mit Erdöl versorgt. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sprach damals von „Angriffen auf die Energiesicherheit“ des Landes. Die Staatsführung in Kiew widersprach dieser Darstellung und erklärte, Ungarn habe trotz aller Warnungen der Europäischen Union und der Ukraine seine Abhängigkeit von Russland aufrechterhalten.
Selenskyj wirft Ungarn Drohnenflüge über ukrainischem Gebiet vor
27. September 2025 – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wirft Ungarn vor, mit Aufklärungsdrohnen ukrainischen Luftraum verletzt zu haben. #Ukraine #StandWithUkraine #EuropeanUnion #EasternEurope #Hungary #DroneIncursion
13.11.2025 21:46 — 👍 5 🔁 1 💬 0 📌 0
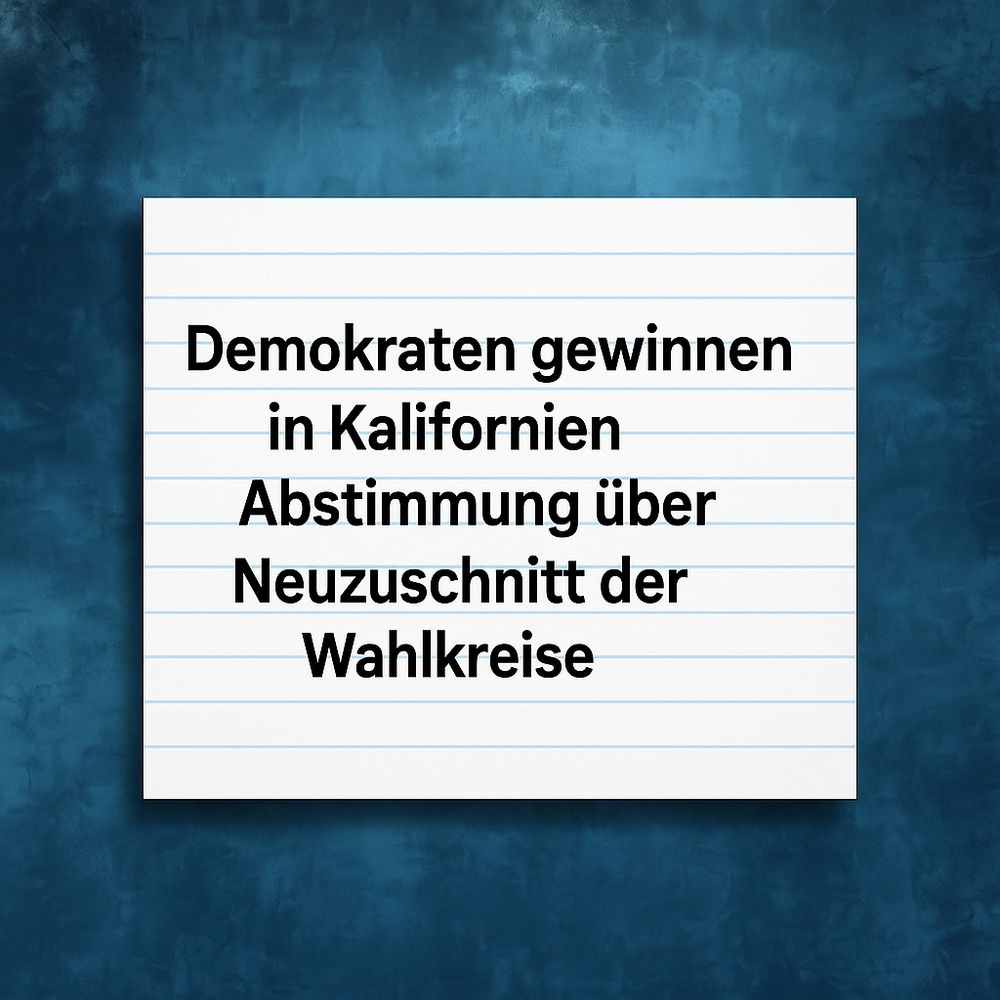
Dieses Verfahren nutzen insbesondere die Republikaner, aber auch hin und wieder die Demokraten, um sich durch gezieltes Zuschneiden der Wahlkreise strukturelle Vorteile zu verschaffen. Das sorgt regelmäßig für Spannungen, da es die Sitzverteilung im US-Repräsentantenhaus beeinflusst.
Im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat Kalifornien brachte Gouverneur Gavin Newsom gemeinsam mit den Demokraten eine Reform ein, die den Zuschnitt der Wahlkreise neu regelt. Die Abstimmung über den Neuzuschnitt, bekannt als „Proposition 50“, wurde am 4. November 2025 abgehalten und 64,1 Prozent der Wählerinnen und Wähler stimmten dafür. Ziel ist es, den Demokraten bei den Kongresswahlen 2026 zu helfen, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurückzuerobern.
Newsoms Initiative war eine Reaktion auf Neuziehungen in republikanisch regierten US-Bundesstaaten wie Florida und Texas. Dort hatten die Republikaner auf Anweisung von Präsident Donald Trump die Wahlkreise neu gezogen, um sich mehr Sitze im Repräsentantenhaus zu verschaffen. Die Demokraten in Kalifornien reagierten mit einem eigenen Vorstoß, um den Einfluss der Republikaner im Kongress zu verringern.
Derzeit verfügen die Republikaner nur über eine knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus. Durch den neuen Zuschnitt hoffen die Demokraten, bei den Midterms 2026 zusätzliche Mandate zu gewinnen. Kalifornien wird derzeit durch 43 demokratische und 9 republikanische Abgeordnete vertreten. Nach Wahlanalysen könnten die Demokraten bis zu 5 zusätzliche Sitze gewinnen und so die Mehrheit im US-Kongress in Washington, D.C., zurückerobern.
Im Gegensatz zu Florida und Texas wurde der Neuzuschnitt in Kalifornien nicht allein durch politische Entscheidungsträger, sondern auch durch ein Votum der Bevölkerung legitimiert. Der Prozess erfolgte auf Initiative der kalifornischen Regierung und der demokratischen Parlamentsmehrheit. Eine unabhängige Kommission war diesmal nicht beteiligt.
Demokraten gewinnen in Kalifornien Abstimmung über Neuzuschnitt der Wahlkreise
In den USA werden Wahlkreise alle zehn Jahre auf der Grundlage der Volkszählung neu festgelegt. Doch immer wieder kommt es zu politisch motivierten Neuziehungen, dem Gerrymandering. #CA #GavinNewsom #Prop50 #USCongress
09.11.2025 19:18 — 👍 27 🔁 5 💬 1 📌 0

In New York setzte sich der linke Demokrat Zohran Mamdani als neuer Bürgermeister durch, während in New Jersey und Virginia demokratische Kandidatinnen die Gouverneursämter gewannen. US-Präsident Donald Trump räumte ein, der Wahlabend sei „nicht gut“ für seine Partei gewesen. Die Erfolge verschaffen den Demokraten Rückenwind für die Zwischenwahlen 2026, bei denen das gesamte Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats neu gewählt werden.
Trump und die Republikaner suchen nach Erklärungen für die Niederlagen. Der Präsident verwies auf den „Shutdown“, den er als eine Ursache nannte, eine Krise, die er selbst verursacht hatte. Der Regierungsstillstand im Haushaltsstreit hatte viele Amerikaner verärgert. Währenddessen müssen Hunderttausende Beschäftigte in Bundesbehörden ohne Bezahlung zu Hause bleiben oder weiterarbeiten. Republikanische Parteikollegen machten Trumps Konfrontationskurs und die chaotische Haushaltslage mitverantwortlich.
Mit Zohran Mamdani tritt in New York ein charismatischer Linkspolitiker auf die nationale Bühne. Der 34-Jährige kündigt ein Rathaus an, das „für Integrität, Mut und neue Lösungen“ steht, und will zeigen, „was eine Regierung leisten kann, wenn gewöhnliche Menschen statt Milliardäre an erster Stelle stehen“. Sein Übergangsteam besteht ausschließlich aus Frauen. Ab Januar 2026 übernimmt Mamdani die Verantwortung für den 116-Milliarden-Dollar-Haushalt der Metropole. Mit seinem Programm setzt er auf bezahlbares Wohnen, kostenlose Kinderbetreuung und bessere Verkehrsanbindungen, finanziert durch höhere Steuern auf hohe Einkommen und Unternehmensgewinne.
Mamdani hat eine breite Unterstützerbasis, doch sein Kurs stößt auch auf Kritik. Teile der jüdischen Gemeinschaft New Yorks äußerten ihre Sorgen über seine Israelkritik. Mamdani betonte jedoch mehrfach seinen Standpunkt gegen Antisemitismus und erklärte, er werde „immer an der Seite unserer jüdischen Nachbarn stehen“.
Demokraten feiern wichtige Wahlsiege in den USA
Nach Niederlagen der Republikaner in mehreren US-Bundesstaaten, darunter New York, New Jersey und Virginia, steht fest: Die Demokraten haben bei den jüngsten US-Wahlen am 4. November 2025 wichtige Siege errungen. #ZohranMamdani #ProgressivePolitics
07.11.2025 18:02 — 👍 15 🔁 2 💬 0 📌 0

Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt sie mit rund 27 von 150 Sitzen vor der rechtspopulistischen Partei, Partij voor de Vrijheid (PVV), von Geert Wilders, die nur noch 26 Mandate erzielte. Damit verliert Wilders deutlich an Rückhalt, nachdem seine PVV 2023 noch stärkste Kraft gewesen war.
Für D66 ist das Ergebnis ein „historischer Sieg“. Erstmals in ihrer Geschichte wird sie stärkste Partei. Jetten kündigte an, rasch eine stabile Regierung „der breiten Mitte“ zu bilden. Die Wählerinnen und Wähler hätten genug von Spielchen, sagte er, und erwarteten nun von den Parteien konstruktive Zusammenarbeit. Mit weniger als 17 Prozent der Stimmen hat erstmals eine Partei mit so geringem Anteil den Wahlsieg errungen. Das ist ein Beleg dafür, wie vielfältig und zugleich zersplittert die niederländische Politik geworden ist. Die Wahlbeteiligung lag bei 78 Prozent.
Für eine Mehrheit sind mindestens vier Parteien im Parlament nötig. Für D66 gelten die Christdemokraten Christen-Democratisch Appèl (CDA) und die rechtsliberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) als mögliche Koalitionspartner. Eine weitere Partei wird jedoch benötigt, um die Mehrheit im Parlament zu erreichen. Noch etwa 90000 ausstehende Briefwahlstimmen dürften vor allem D66 zusätzlich stärken, weshalb Jetten mit dem Auftrag zur Regierungsbildung rechnet.
Die Neuwahl war nötig geworden, nachdem im Juni 2025 die rechtskonservative Vier-Parteien-Koalition zerbrochen war. Um die Koalition zu ermöglichen, hatte Wilders auf das Amt des Premierministers verzichtet. Es übernahm der parteilose Sicherheits- und Verwaltungsexperte Dick Schoof. Nach nur elf Monaten provozierte Wilders den Bruch. Neuwahlen folgten am 29. Oktober 2025.
Wilders weigert sich bislang, die Niederlage anzuerkennen. Auf der Plattform X warf er den Medien Arroganz vor und verbreitete unbelegte Vorwürfe über Wahlbetrug. Die Behörden fanden keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten.
Vorläufiges Ergebnis: Linksliberale gewinnen Wahl in den Niederlanden
31. Oktober 2025 – Die proeuropäische, linksliberale Partei Democraten 66 (D66) unter Rob Jetten hat die Parlamentswahl in den Niederlanden knapp gewonnen. #NetherlandsElection #RobJetten #D66 #Liberals #NiederlandeWahl #Europa
02.11.2025 20:45 — 👍 41 🔁 2 💬 2 📌 0

Das zweijährige Mädchen erhielt im März 2025 im Alter von nur 18 Monaten die schwere Diagnose eines aggressiven Hirntumors im Stadium 4. Nach einer komplizierten Operation, bei der der Tumor vollständig entfernt werden konnte, stellten die Ärzte fest, dass es sich um eine besonders gefährliche Form von Krebs handelt. Lilah muss sich nun einer langen und belastenden Behandlung mit Chemotherapie und Stammzelltherapie unterziehen. Ihre Familie verbringt während dieser schweren Zeit jede freie Minute an ihrer Seite im Krankenhaus, um sie zu unterstützen.
Die Mutter, Kathleen Smoot, teilte auf Instagram ein Video, das schnell viral ging. In dem kurzen Clip ist Lilah zu sehen, wie sie fröhlich zu Taylor Swifts Song „The Fate of Ophelia“ tanzt und dabei lächelnd sagt: „Das ist meine Freundin.“ Das Video verbreitete sich rasend schnell, erreichte Millionen Aufrufe und berührte schließlich auch Taylor Swift selbst. Die Sängerin reagierte tief bewegt und unterstützte die GoFundMe-Kampagne der Familie mit einer großzügigen Spende von 100.000 US-Dollar (etwa 85.760 Euro). Auf der Spendenplattform schrieb sie: „Ich sende meiner Freundin Lilah die größte Umarmung! Alles Liebe, Taylor.“
Swifts großzügige Spende löste eine beeindruckende Welle an Hilfsbereitschaft und Solidarität aus. Ihre Fans, besser bekannt als Swifties, spendeten innerhalb kürzester Zeit sogar noch mehr als ihr Idol selbst. Insgesamt kamen über 263.000 US-Dollar (etwa 225.000 Euro) zusammen. Genug, um die medizinische Versorgung der kleinen Lilah langfristig zu sichern.
Auf der GoFundMe-Seite bedankte sich die Mutter Kathleen öffentlich bei Taylor Swift und ihren Fans: „Ihr seid absolut großartig. Die finanzielle Last wurde meiner Familie vollständig genommen.“ Sie hofft nun, dass Lilahs traurige Geschichte in der Gesellschaft mehr Bewusstsein für Kinderkrebs schafft. Zum Abschluss ihres Dankespostings zitierte sie aus Swifts Hit „Shake It Off“: „The haters gonna hate, but I'm just gonna shake it off.“
Taylor Swift und ihre Fans helfen krebskrankem Mädchen
19. Oktober 2025 – Die Geschichte der kleinen Lilah Smoot aus North Carolina bewegt derzeit Millionen Menschen in den USA sowie weltweit. #TaylorSwift #Swifties #TogetherForLilah #ChildhoodCancerAwareness #SocialMedia #GoFundMe #PowerOfKindness
29.10.2025 17:31 — 👍 11 🔁 1 💬 0 📌 0

Keiner der 45 zentralen Indikatoren zur CO₂-Emissionsreduktion befindet sich auf dem notwendigen Kurs, die Erderwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen. Stromerzeugung, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft zeigen weltweit dasselbe Bild: zu langsam, zu schwach, zu spät. Führende Fachleute aus der Klimaforschung und Klimapolitik, darunter Bill Hare von Climate Analytics und Kelly Levin vom World Resources Institute, warnen eindringlich, dass sich das verbleibende Zeitfenster, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten, in rasantem Tempo schließt.
Die Studie mahnt, dass die Welt beim Klimaschutz gefährlich langsam vorankommt. Während Politikerinnen und Politiker weltweit große Versprechen zur Klimaneutralität abgeben, fließen weiterhin Milliardenbeträge in Subventionen für fossile Energieträger. Der Ausbau erneuerbarer Energien stockt, die CO₂-Emissionen steigen wieder, und auch reiche Länder verfehlen derzeit ihre eigenen Klimaziele. Diese Zögerlichkeit hat verheerende Folgen: Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände nehmen zu.
Inselstaaten, Länder des globalen Südens und indigene Gemeinschaften leiden mit am stärksten unter den Folgen des Klimawandels. Der Klimawandel wird insbesondere durch den massiven Ausstoß von CO₂ und anderen Treibhausgasen in den Industrienationen verursacht.
Die Studie fordert ein sofortiges Umsteuern in allen Sektoren, vor allem in der Energieerzeugung und im Verkehr. Sie richtet ihre Forderung an alle Länder der Welt, betont jedoch die besondere Verantwortung der Industrienationen. Dazu gehören der rasche Ausstieg aus fossilen Energieträgern, etwa Kohle, Erdöl und Erdgas, der Ausbau erneuerbarer Energien, darunter Wind- und Solarenergie sowie Biomasse, und Investitionen in moderne Speichertechnologien wie Batteriespeicher und Wasserstoffsysteme.
22. Oktober 2025 – Mit den Worten „Alle Systeme blinken rot“ zeigen die Klimaforschungsinstitute Climate Analytics und World Resources Institute im neuen State of Climate Action Report 2025, wie deutlich die globalen Fortschritte beim Klimaschutz hinter den internationalen Zielen zurückbleiben.
26.10.2025 15:50 — 👍 11 🔁 1 💬 0 📌 0

Merz begründet seine Haltung mit den fundamentalen Unterschieden zwischen CDU/CSU (Christlich Demokratische Union Deutschlands/Christlich-Soziale Union in Bayern) und AfD (Alternative für Deutschland). Die AfD, so Merz, stelle Grundprinzipien der deutschen Demokratie infrage: die Europäische Union, die NATO-Bindung, die soziale Marktwirtschaft und die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Mit dieser Aussage bekräftigt Merz die Brandmauer und erklärt sie zu einem leitenden Prinzip seiner Amtsführung.
In ostdeutschen Landesverbänden, etwa in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, gibt es Stimmen, die auf kommunaler Ebene ein pragmatischeres Verhältnis zur AfD fordern. Mit seiner Positionierung setzt Merz auch eine deutliche Botschaft an die eigene Partei: an die Teile der Union (CDU/CSU), die die Abgrenzung zur AfD infrage stellen oder lockern wollen. Für die Bundes-CDU schafft Merz damit Klarheit: Die AfD ist kein potenzieller Partner, sondern der politische Hauptgegner. Merz verankert seine Partei fest in einem demokratischen Selbstverständnis und im Anspruch, die politische Mitte zurückzugewinnen, statt nach rechtsaußen zu schielen.
Merz muss nun zeigen, dass sein politischer Kurs in allen Landesverbänden Bestand hat, auch dort, wo CDU-Kommunalpolitiker bereits versuchen, die Abgrenzung zur AfD aufzuweichen. Die „Brandmauer“ funktioniert nur, wenn sie tatsächlich überall steht. In Ostdeutschland, insbesondere in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, wo gesellschaftliche Frustration und AfD-Erfolge besonders ausgeprägt sind, wird dies zum Prüfstein seiner Kanzlerschaft. Zudem steht die CDU vor der Aufgabe, die Wähler zurückzugewinnen, die sich von ihr abgewandt haben, ohne dabei in die rechtspopulistische Falle zu geraten. Merz setzt also auf ein langfristiges Ziel: die Erneuerung der Union als moderne, deutsche, europäisch orientierte und rechtsstaatliche Volkspartei.
Bundeskanzler Friedrich Merz hat am 18. Oktober 2025 bei einem Bürgerdialog im Sauerland unmissverständlich erklärt: „Mit mir als CDU-Vorsitzenden wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben.“ Damit zieht er eine Linie, die mehr ist als nur Wahlkampfrhetorik. #Brandmauer #KeineKoalitionMitDerAfD
21.10.2025 16:17 — 👍 6 🔁 0 💬 7 📌 0

Schon 2023 erwies sich rund jede sechste Infektion, etwa 16 Prozent, als resistent gegen mindestens ein gängiges Antibiotikum. Zwischen 2018 und 2023 nahm die Resistenz bei mehr als 40 Prozent der untersuchten Erreger-Antibiotika-Kombinationen um jährlich 5 bis 15 Prozent zu. Die WHO warnt: Routinebehandlungen und Operationen geraten zunehmend in Gefahr, da Medikamente, die einst zuverlässig wirkten, ihre Wirksamkeit verlieren könnten.
Am höchsten sind die Resistenzraten in ärmeren Regionen: In Südostasien, etwa in Bangladesch, und im östlichen Mittelmeerraum, darunter in Ägypten, ist rund jede dritte Infektion resistent gegenüber wichtigen Antibiotikaklassen. In Afrika, etwa in Nigeria, betrifft es rund jede fünfte. Auch in Europa, etwa in Italien, und im westlichen Pazifikraum, darunter in den Philippinen, nehmen die Fallzahlen resistenter Infektionen weiter zu. Besonders problematisch sind gramnegative Bakterien wie Escherichia coli mit Resistenzraten von über 40 Prozent und Klebsiella pneumoniae mit rund 55 Prozent. Laut WHO-Bericht erreichen die Resistenzraten dieser und anderer gramnegativer Erreger in einigen afrikanischen Ländern Werte von bis zu 70 Prozent oder mehr, ohne dass diese namentlich genannt werden. Auch grampositive Bakterien wie Staphylococcus aureus oder Enterococcus faecium entwickeln zunehmend Resistenzen, wenn auch auf niedrigem Niveau. Viele der untersuchten Bakterienstämme zeigen zudem Mehrfachresistenzen gegenüber wichtigen Antibiotikaklassen wie Drittgenerations-Cephalosporinen und Carbapenemen.
Bleibt der Trend bestehen, drohen schwerwiegende Folgen: Medizinische Behandlungen und Operationen wie Kaiserschnitte, Chemotherapien oder Hüftoperationen könnten künftig wieder lebensgefährlich werden. Krankenhausaufenthalte bei betroffenen Patienten würden sich verlängern, während Behandlungskosten steigen und Todesfälle zunehmen, besonders in Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen.
WHO-Bericht: Antibiotikaresistenzen nehmen weltweit deutlich zu
Am 13. Oktober 2025 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) ihren neuen Global Antibiotic Resistance Surveillance Report und stellt fest: Weltweit nehmen Antibiotikaresistenzen in raschem Tempo zu. #AntibioticResistance
19.10.2025 15:55 — 👍 12 🔁 0 💬 0 📌 0

Nach wochenlangen, unermüdlichen Einsätzen gelang es der kalifornischen Feuerwehr, die Brände schließlich unter Kontrolle zu bringen und vollständig zu löschen. Lange suchten Brandermittler und Forensiker nach der Ursache der Feuer, die ganze Stadtviertel in Schutt und Asche gelegt und Zehntausende Menschen zur Flucht gezwungen hatten.
Die Spur der Ermittler führte zurück zum Neujahrstag, dem 1. Januar 2025, als zunächst ein kleineres Feuer in einem Waldgebiet nahe Los Angeles ausbrach. Obwohl die Flammen rasch gelöscht wurden, glimmte das Feuer unterirdisch weiter. Eine Woche später, am 7. Januar 2025, entfachte es erneut, befeuert durch starke Winde. Das Feuer entwickelte sich binnen kürzester Zeit zu einem großflächigen Brand, der später als „Palisades Fire“ bekannt wurde.
Ein bemerkenswertes Detail der Ermittlungen: Bei der Auswertung seines Smartphones stießen Ermittler des Federal Bureau of Investigation (FBI) auf ein mit ChatGPT erstelltes Bild, das eine brennende Stadt zeigte. Diese digitale Spur führte das FBI gemeinsam mit den Brandermittlern des Los Angeles Fire Department schließlich auf seine Fährte.
Die Brände forderten 31 Todesopfer und zerstörten mehr als 16000 Gebäude. Zahlreiche Familien verloren ihr Zuhause, ganze Stadtteile von Los Angeles lagen in Trümmern. Der wirtschaftliche Schaden geht in die Milliardenhöhe und der Wiederaufbau ganzer Wohngebiete dürfte Jahre dauern. Auch die Umwelt leidet noch immer unter den Folgen der massiven Rauch- und Schadstoffbelastung.
Über die Motive des mutmaßlichen Brandstifters ist bisher nichts bekannt. Die Polizei prüft, ob er mit weiteren Bränden in Verbindung steht. Die Justiz bereitet die Anklage gegen den Mann vor, indessen kämpft Kalifornien weiter mit den Folgen und dem mühsamen Wiederaufbau. Der Fall verdeutlicht, dass moderne Technologien wie künstliche Intelligenz in Ermittlungsverfahren eine immer größere Rolle spielen.
9. Oktober 2025 – Nach monatelangen Ermittlungen von Polizei, Feuerwehr und dem FBI ist den US-Behörden ein entscheidender Durchbruch gelungen: In Florida wurde ein 29-jähriger Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die verheerenden Brände rund um Los Angeles, Anfang des Jahres gelegt zu haben.
18.10.2025 08:18 — 👍 5 🔁 0 💬 0 📌 1

Deutschland lehnt EU-Pläne zur Chatkontrolle ab
Der Entwurf hätte es ermöglicht, dass Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram Nachrichten auf verdächtige Inhalte prüfen, noch bevor sie verschlüsselt werden. Zwar sollte der Entwurf den sexuellen Missbrauch von Kindern im Internet bekämpfen, doch der Preis wäre ein massiver Eingriff in die Privatsphäre aller Nutzerinnen und Nutzer in der Europäischen Union gewesen.
Kern des umstrittenen Vorhabens ist das Client-Side-Scanning: Inhalte würden direkt auf dem Endgerät durchsucht, bevor sie gesendet werden. Damit entstünde eine technische Infrastruktur, die faktisch einer flächendeckenden Überwachung gleichkäme. Datenschützer befürchten, dass dadurch nicht nur Missbrauchsfälle, sondern auch vertrauliche Kommunikation betroffen wären.
Der Schutz von Kindern und die Wahrung der digitalen Freiheit bleiben sensible Themen. Viele Fachleute warnen, darunter der parteiunabhängige Europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski sowie zahlreiche Experten für IT-Sicherheit und Kryptografie, dass eine solche Überwachung schnell über ihr ursprüngliches Ziel hinausgehen könnte und am Ende nicht nur Täter, sondern auch Unschuldige trifft, etwa durch Fehlalarme infolge fehlerhafter Algorithmen. Das würde das Vertrauen in digitale Kommunikation schädigen. Ist eine solche Überwachungsinfrastruktur erst geschaffen, könnte sie zudem für politische oder wirtschaftliche Zwecke missbraucht werden.
Mit ihrer Ablehnung setzt die Bundesregierung ein starkes Zeichen für Datenschutz und Grundrechte in Deutschland. Sicherheit darf die Freiheit nicht einschränken, zugleich darf der Schutz von Kindern nicht vernachlässigt werden. Die EU arbeitet an weiteren und wirksamen Strategien gegen sexuellen Kindesmissbrauch. Sie muss dabei jedoch gewährleisten, dass der Kampf gegen Verbrechen nicht auf Kosten der Grundrechte geführt wird.
8. Oktober 2025 – Die Bundesregierung hat den EU-Vorschlag für eine Chatkontrolle entschieden zurückgewiesen. Damit stellten sich sowohl SPD als auch CDU/CSU unmissverständlich gegen die Pläne aus Brüssel, die private Online-Kommunikation stärker überwachen wollen. #DigitaleFreiheit #Grundrechte
13.10.2025 13:15 — 👍 10 🔁 0 💬 1 📌 0

Nach Angaben der US-Regierung soll der Einsatz dem Schutz von Regierungsmitarbeitern und -einrichtungen sowie der Eindämmung anhaltender Proteste dienen. Viele Beobachter aus Politik und Justiz, darunter der frühere US-Bundesrichter Michael Luttig, die Juristin Laurence Tribe von der Harvard University und mehrere demokratische Abgeordnete, sehen darin einen politischen Vorwand, um Trumps Agenda Project 2025 voranzutreiben. Die Anordnung erfolgte gegen den erklärten Willen des Staates Illinois und der Stadt Chicago. Zugleich versuchte die US-Regierung, Truppen aus Kalifornien nach Portland zu verlegen.
In Illinois reagierten die Staatsregierung und die Stadtregierung von Chicago empört. Der Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, bezeichnete die Anordnung als „Invasionsversuch“ und kritisierte, dass Entscheidungen über Truppenbewegungen ohne Rücksprache getroffen wurden. Vertreter der Demokraten, darunter die frühere Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi und Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, warfen der US-Regierung vor, militärische Mittel politisch einzusetzen und gezielt demokratisch regierte Städte destabilisieren zu wollen.
Als die US-Regierung den Einsatz der Nationalgarde in Chicago plante, erließ US-Bundesrichterin Karin Immergut am 6. Oktober 2025 in Oregon fast zeitgleich eine einstweilige Verfügung: Die Verlegung von Nationalgardisten nach Portland ist vorerst untersagt. Begründung: Für die geplanten Einsätze fehle eine ausreichende rechtliche Grundlage, die ein militärisches Eingreifen rechtfertigen würde. Zudem stellten die weiterhin anhaltenden Proteste in Portland keine Bedrohung dar.
Die Auseinandersetzung verdeutlicht, wie schwierig es ist, Sicherheitsinteressen mit verfassungsrechtlichen Prinzipien zu vereinbaren, gerade dann, wenn ein US-Präsident wie Trump gezielt versucht, die demokratischen Grundlagen des Landes zu zersetzen.
Einsatz der Nationalgarde in Chicago und Portland löst weitere rechtliche Debatte aus
US-Präsident Donald Trump hat am 5. Oktober 2025 den Einsatz von rund 300 Nationalgardisten in Chicago angeordnet. Bislang blieb es jedoch bei der Ankündigung, da die Maßnahme auf breiten Widerstand gestoßen ist.
09.10.2025 11:11 — 👍 10 🔁 1 💬 0 📌 0

Eine am 3. Oktober 2025 veröffentlichte Studie zeigt: Unser Planet reflektiert heute deutlich weniger Sonnenlicht als noch vor zwei Jahrzehnten. Satellitendaten belegen, dass die Erde zwischen 2001 und 2024 kontinuierlich „dunkler“ geworden ist. Das bedeutet: Statt Sonnenstrahlen ins All zurückzuwerfen, nimmt die Erde mehr Energie auf und speichert sie, mit spürbaren Folgen für das globale Klima.
Norman Loeb und sein Forschungsteam am NASA Langley Research Center in Hampton, Virginia, stellten fest, dass vor allem die Nordhalbkugel der Erde weniger Sonnenlicht reflektiert. Der Rückgang für den gesamten Planeten beträgt durchschnittlich rund 0,34 Watt pro Quadratmeter und pro Jahrzehnt. Auf den ersten Blick wirkt das gering, doch hochgerechnet auf die gesamte Erdoberfläche entspricht das enormen Energiemengen.
Die Hauptursache ist das Schmelzen von Eis und Schnee, die normalerweise große Teile der Sonneneinstrahlung zurückwerfen. Auch Veränderungen in der Wolkenbildung sowie der Rückgang von Aerosolen infolge strengerer Umweltauflagen tragen dazu bei. Paradoxerweise führt saubere Luft in manchen Regionen der Welt dazu, dass weniger reflektierende Wolken entstehen.
Die zusätzliche Sonnenenergie verstärkt die Erderwärmung und kann einen gefährlichen Kreislauf in Gang setzen: steigende Temperaturen – schrumpfende Eisflächen – geringere Reflexion – noch stärkere Erderwärmung. Am stärksten betroffen sind die nördlichen Regionen der Erde wie Europa, Nordamerika und Russland.
Die Verdunkelung der Erde ist keine Nebensächlichkeit, sondern ein ernstzunehmendes Warnzeichen. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie stark menschliche Eingriffe das Klimasystem verändern und dass auch gut gemeinte Maßnahmen für das Klima unvorhersehbare Folgen haben können. Die Studie unterstreicht: Klimaschutz heißt nicht nur CO₂-Emissionen senken, sondern auch das gesamte Zusammenspiel von Atmosphäre, Ozeanen und Landflächen im Blick zu behalten.
Eine am 3. Oktober 2025 veröffentlichte Studie zeigt: Unser Planet reflektiert heute deutlich weniger Sonnenlicht als noch vor zwei Jahrzehnten. Satellitendaten belegen, dass die Erde zwischen 2001 und 2024 kontinuierlich „dunkler“ geworden ist. #Klimakrise #Erderwärmung #PlanetErde #ClimateAction
06.10.2025 13:44 — 👍 10 🔁 2 💬 0 📌 0

Das Treffen war außergewöhnlich: Derartige militärische Versammlungen sind traditionell unpolitisch. Diesmal jedoch prägten politische Botschaften und martialische Rhetorik die Versammlung mit Hunderten von ranghohen Offizieren. Schon die Umbenennung des „Department of Defense“ in „Department of War“ machte die Abkehr vom klassischen Verteidigungsauftrag der USA deutlich.
US-Verteidigungsminister Hegseth verkündete eine neue Leitlinie: Die Streitkräfte seien künftig nicht länger der Verteidigung, sondern auf permanente Kriegsvorbereitung verpflichtet. Das Militär müsse stets auf Sieg ausgerichtet sein. Zugleich griff er die internen Strukturen und den Geist der Streitkräfte an, von einer angeblich überzogenen Bürokratie über mangelnde Disziplin bis hin zu einer Militärkultur, die er als „weich“ bezeichnete. Selbst Themen wie Körpergewicht oder äußeres Erscheinungsbild von Offizieren wurden in seinen Reden politisiert.
Trump verschärfte diese martialische Rhetorik noch mehr. Er sprach von einer „Gefahr von innen“. Nach seiner Darstellung seien amerikanische Städte nicht nur Orte des zivilen Lebens, sondern auch potenzielle Trainingsfelder und sogar künftige Schlachtfelder für das US-Militär. Gemeint waren damit vor allem die von den Demokraten regierten Städte.
Politische Beobachter werten dies als gezielte Strategie, das Militär in innenpolitische Konflikte einzubinden. Das wäre ein weiterer Tabubruch, der das Fundament der US-Demokratie gefährdet.
Die Botschaften von Trump und Hegseth könnten tiefgreifende Folgen haben. Sie verschieben das Verhältnis von Politik und Militär, indem sie die Streitkräfte stärker ideologisch binden. Kritiker warnen, dass das Militär so nicht mehr als neutrale Institution agiert und zunehmend zum Werkzeug einer politischen Agenda werde. In den USA, wo die zivile Kontrolle über die Armee fest verankert ist, gefährdet dieser Kurs die Grundlagen der demokratischen Ordnung.
Trump und Hegseth schwören US-Militär auf Krieg ein
Am 30. September 2025 trat US-Präsident Donald Trump gemeinsam mit seinem Verteidigungsminister Pete Hegseth vor die oberste Führung der US-Streitkräfte in Quantico. #USA #Kriegsrhetorik #USMilitary #USOfficers #USDemocracyAtRisk #USPolitics
03.10.2025 13:22 — 👍 6 🔁 1 💬 1 📌 0

Fast elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll
Bundesagrarminister Alois Rainer bezeichnet diese Zahl als alarmierende Entwicklung. Doch nicht allein Industrie und Handel tragen Verantwortung. Rund 60 Prozent der Verschwendung entstehen in privaten Haushalten. Darum ist es eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.
Die Gründe sind vielfältig. Supermärkte sortieren Waren oft Tage vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums aus. Produzenten stellen mehr her, als tatsächlich gebraucht wird, damit Regale immer voll sind. Viele Menschen kaufen mehr ein, als sie benötigen, lagern Lebensmittel falsch oder verwechseln „mindestens haltbar bis“ mit „sofort ungenießbar“. Hinzu kommen rechtliche Barrieren: Containern ist weiterhin strafbar. So bleibt überschüssige, aber noch essbare Nahrung ungenutzt, statt an Bedürftige verteilt zu werden.
Jedes weggeworfene Lebensmittel bedeutet nicht nur verlorene Nahrung, sondern auch verschwendete Ressourcen wie Wasser, Energie und landwirtschaftliche Flächen. Beim Verrotten entsteht zudem Methan, ein klimaschädliches Gas, das den Treibhauseffekt verstärkt. Besonders bitter: Während hierzulande tonnenweise Lebensmittel weggeworfen werden, leiden Menschen in Deutschland und weltweit unter Mangelernährung. Die soziale Ungleichheit zwischen Überfluss und Mangel verschärft sich weiter.
Mit der Kampagne „Zu gut für die Tonne“ startet vom 29. September bis 6. Oktober 2025 eine deutschlandweite Aktionswoche, die für das Thema sensibilisieren soll. Sie gibt Tipps zur Lagerung, zur Einkaufsplanung und zur Resteverwertung. So wertvoll diese Aktion auch ist, eine Woche reicht nicht aus. Es braucht dauerhafte Veränderungen: klare Regeln für den Handel, weniger Hürden bei der Weitergabe von Lebensmitteln und eine Entkriminalisierung der Lebensmittelrettung.
27. September 2025 – In Deutschland werden jährlich fast elf Millionen Tonnen wertvolle Lebensmittel weggeworfen. Brot, Obst, Gemüse, Fleisch und Milchprodukte verschwinden in einer Größenordnung, die schwer vorstellbar ist. #FoodWaste #ZuGutFürDieTonne #Lebensmittelrettung #EssenStattMüll
29.09.2025 17:27 — 👍 41 🔁 10 💬 3 📌 2

EU-Staaten planen Drohnenabwehr: Finnland fordert gemeinsame Verantwortung
Dabei geht es nicht um Betonmauern, sondern um ein vernetztes Abwehrsystem mit Sensoren, Radar, künstlicher Intelligenz und Abfangmechanismen. Ziel ist es, zu verhindern, dass russische Drohnen erneut in den europäischen Luftraum eindringen und zugleich Europas Grenzen zu schützen.
Deutliche Worte kommen aus Finnland. Der finnische Verteidigungsminister Antti Häkkänen warnt davor, die militärische und politische Verantwortung allein auf die Länder an der russischen Grenze abzuwälzen. Wer heute Finnlands Grenze und die Ostgrenzen der baltischen Staaten nicht schützt, könnte morgen an seiner eigenen Grenze bedroht sein. Häkkänen macht deutlich: Sicherheit ist eine europäische Pflicht. So wie Finnland in früheren Krisen südliche EU-Staaten unterstützt hat, fordert Finnland nun Solidarität von den west- und südeuropäischen Partnern.
Der geplante Drohnenwall soll als mehrschichtiges Abwehrsystem funktionieren. Radaranlagen und optische Sensoren sollen Drohnen erfassen, künstliche Intelligenz soll sie analysieren und klassifizieren. Störsender und Abfangsysteme greifen im Ernstfall ein, stören die Steuerung feindlicher Drohnen und machen sie unschädlich. Doch die Umsetzung ist schwierig. Die Kosten sind enorm, und die Systeme komplex. Zudem besteht die Gefahr, dass auch einfache Drohnen immer wieder kostspielige Abwehrmaßnahmen auslösen.
Die Finanzierung ist ungeklärt: Wer übernimmt die Milliardenkosten? Welche EU-Staaten tragen welchen Anteil? Im Westen und Süden Europas wird die Bedrohung weniger stark wahrgenommen. Entsprechend zurückhaltend ist die Unterstützung. Noch ist nicht entschieden, ob die Europäische Union eigene Industrieprogramme auflegt oder nationale Projekte bündelt. Ob der Drohnenwall gelingt, hängt von der Solidarität, der Abwehrtechnik und dem politischen Willen der EU-Mitgliedstaaten ab.
26. September 2025 – Die Europäische Union reagiert auf die wachsende Bedrohung durch russische Drohnenangriffe mit einem neuen Plan. Neun EU-Mitgliedstaaten, darunter Dänemark und Polen, sowie die Ukraine wollen gemeinsam einen „Drohnenwall“ aufbauen. #EuropeanUnion #Drohnenabwehr #Finnland
28.09.2025 07:57 — 👍 14 🔁 1 💬 1 📌 0

66 Prozent der Befragten verbinden mit dem Label Verlässlichkeit, Qualität und Sicherheit, ein Spitzenwert, mit dem Deutschland selbst Länder wie die Schweiz oder Japan übertrifft. Für die Studie wurden insgesamt 20000 Konsumentinnen und Konsumenten in zehn Ländern befragt.
Das Siegel ist nicht nur hochgeschätzt, sondern auch von erheblichem wirtschaftlichem Wert. 65 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten weltweit geben an, dass die Herkunftsangabe Made in Germany ihre Kaufentscheidung positiv beeinflusst. Damit stärkt das Label unmittelbar die internationale Wettbewerbsfähigkeit der exportorientierten deutschen Wirtschaft.
Ursprünglich wurde Made in Germany im 19. Jahrhundert von Großbritannien eingeführt, um ausländische Produkte zu kennzeichnen. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Aufschrift zu einem Synonym für Spitzenqualität. Besonders in der Automobilindustrie, im Maschinenbau und bei Haushaltsgeräten ist dieses Image bis heute fest verankert.
Deutschland überzeugt bei klassischen Industrien. Doch die Studie zeigt auch Schwächen: In Bereichen wie Hightech, Künstlicher Intelligenz und Elektromobilität wird den USA und Japan die größere Innovationskraft zugeschrieben. Das macht deutlich: Auf den Wert des Siegels allein kann sich Deutschland nicht verlassen. Investitionen in Zukunftstechnologien wie etwa Batterietechnologie, Quantencomputing, Wasserstofftechnologie und nachhaltige Produktionsverfahren sind ebenso unerlässlich, um den technologischen Anschluss nicht zu verlieren.
Made in Germany ist mehr als eine Herkunftsangabe. Es ist ein Versprechen an die Welt. Dieses Versprechen muss täglich neu eingelöst werden, durch Innovation, Nachhaltigkeit und Mut zur Erneuerung. Das Qualitätssiegel wird seine Strahlkraft nur behalten, wenn Deutschland Qualität und Innovation vereint und Menschen ihm auch künftig vertrauen. In Deutschland wie weltweit.
Qualitätssiegel Made in Germany genießt weltweit höchstes Ansehen
Das Herkunftssiegel „Made in Germany“ ist laut einer am 25. September 2025 veröffentlichten Studie des Nürnberger Instituts für Marktentscheidungen das international vertrauenswürdigste. #MadeInGermany #QualitätAusDeutschland
27.09.2025 05:26 — 👍 8 🔁 0 💬 2 📌 1

Am 18. September 2025 veröffentlichte die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Studie, die untersucht, ob extrem rechte Parteien wie die Alternative für Deutschland (AfD) durch Kooperationen gemäßigt werden können. Das Ergebnis ist eindeutig: Eine Einbindung in die politische Mitte führt nicht zu einer Mäßigung dieser Parteien, sondern schwächt vor allem die konservativen Partner, die mit ihnen kooperieren.
Die Studie analysiert Beispiele aus Finnland, Österreich und weiteren europäischen Staaten. Überall zeigt sich ein ähnliches Muster: Sobald konservative Parteien mit rechtspopulistischen Parteien kooperieren, büßen sie an Glaubwürdigkeit und Profil ein. Die extrem rechten Parteien hingegen bleiben bei ihren Kernpositionen, nutzen die zusätzliche Bühne und gewinnen langfristig an Einfluss.
Das oft vorgebrachte Argument, Regierungsverantwortung mache extrem rechte Parteien moderater, wird klar widerlegt. Selbst dort, wo sie zu Kompromissen gezwungen waren, blieb ihre politische Grundhaltung unverändert. Im Gegenteil: Der Zugang zur Macht erleichtert es ihnen, ihre Positionen zu normalisieren und weiter zu verbreiten.
Am deutlichsten zeigt sich dies am Beispiel Deutschlands. Die AfD gilt in der Studie als „autoritäre und rechtsextremistische Partei“, die durch Kooperation nicht gemäßigt, sondern vielmehr legitimiert werden würde. Jede politische Zusammenarbeit mit ihr gefährdet demokratische Grundwerte und trägt dazu bei, dass extremistische Positionen salonfähig gemacht werden.
Die Studie kommt deshalb zu einer eindeutigen Empfehlung: Demokratische Parteien müssen unmissverständliche Grenzen ziehen. Abgrenzung ist nicht nur moralisch geboten, sondern auch politisch unverzichtbar, um die Glaubwürdigkeit und Stabilität des demokratischen Systems zu bewahren. Wer Rechtspopulisten oder Rechtsextremisten einbindet, schadet sich selbst und stärkt diejenigen, die die Demokratie zerstören wollen.
Am 18. September 2025 veröffentlichte die Konrad-Adenauer-Stiftung eine Studie, die untersucht, ob extrem rechte Parteien wie die Alternative für Deutschland (AfD) durch Kooperationen gemäßigt werden können. #KonradAdenauerStiftung #Studie #EuropaErfahrungen #DemokratieVerteidigen #NieWiederIstJetzt
21.09.2025 18:14 — 👍 76 🔁 26 💬 4 📌 2

Alltag auf Pump: Immer mehr Deutsche müssen sich Geld für Lebensmittel und Kleidung leihen
Lebensmittel, Kleidung und Fahrtkosten sind eigentlich Ausgaben, die selbstverständlich aus dem Einkommen bezahlt werden sollten. Doch eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Barclays zeigt: Immer mehr Menschen in Deutschland müssen sich dafür Geld leihen. Was früher die Ausnahme war, ist heute Alltag. „Alltag auf Pump“ betrifft inzwischen nicht mehr nur Einzelne, sondern wird zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem.
Mehr als die Hälfte der unter 50-Jährigen hat in den vergangenen zwei Jahren Geld geliehen, am häufigsten innerhalb der Familie (44 Prozent), dicht gefolgt von Bankkrediten (40 Prozent). Bedenklich ist der Zweck: 26,6 Prozent der Befragten benötigen das Geld für Lebensmittel, 21,4 Prozent für Kleidung und knapp 27 Prozent für ihr Auto. Am stärksten betroffen sind junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren. Zwei Drittel von ihnen mussten bereits Geld aufnehmen, oft kleine Beträge bis 200 Euro. Ein wesentlicher Grund dafür ist die anhaltende Inflation. Zuletzt lag sie bei rund 2,2 Prozent und hat vor allem Lebensmittel verteuert.
Wer ständig Geld leihen muss, gerät schnell in eine Abwärtsspirale. Bankkredite bedeuten zusätzliche Zinsen, innerhalb der Familie führen Schulden zu Spannungen und Schuldgefühlen. Hinzu kommen Scham und die Angst vor Zahlungsunfähigkeit. Für viele junge Menschen, die eigentlich ihre Zukunft planen sollten, wird das Leben so zu einem finanziellen Drahtseilakt, verbunden mit erheblichen psychischen Belastungen.
„Alltag auf Pump“ ist deshalb nicht nur ein privates, sondern auch ein gesellschaftliches Problem. Wer keine Rücklagen bilden kann, verliert an wirtschaftlicher Sicherheit. Gleichzeitig sinkt die Kaufkraft und schwächt die Wirtschaft. Und die soziale Ungleichheit wächst: Während manche weiterhin Vermögen aufbauen, müssen andere für Brot und Milch Schulden machen. Das kann soziale Spannungen auslösen.
Lebensmittel, Kleidung und Fahrtkosten sind eigentlich Ausgaben, die selbstverständlich aus dem Einkommen bezahlt werden sollten. Doch eine aktuelle Umfrage im Auftrag von Barclays zeigt: Immer mehr Menschen in Deutschland müssen sich dafür Geld leihen. #AlltagAufPump #Lebenshaltungskosten #Schulden
21.09.2025 07:51 — 👍 24 🔁 8 💬 2 📌 0

Der Eklat zeigte, wie leicht politische Vereinbarungen scheitern, wenn moralische, rechtliche und parteipolitische Vorbehalte aufeinandertreffen. Die abgesagte Wahl war nicht nur ein Rückschlag für die SPD, sondern auch ein Dämpfer für das Vertrauen in demokratische Prozesse.
Brosius-Gersdorf war ursprünglich als Kandidatin der SPD vorgesehen. Doch ihre Haltung zum Thema Schwangerschaftsabbruch und einige ihrer wissenschaftlichen Texte stießen auf zunehmende Kritik. Innerhalb der Union (CDU/CSU) fehlte schließlich die nötige Unterstützung, sodass sie ihre Kandidatur zurückzog. Dieser Schritt verdeutlichte, wie sehr öffentliche Diskussionen und politische Erwägungen auf höchster Ebene Personalentscheidungen prägen.
Als neue Kandidatin setzt die SPD nun auf Sigrid Emmenegger, derzeit Richterin am Bundesverwaltungsgericht. Sie gilt als fachlich exzellent, politisch unauffällig und kompromissbereit. Genau diese Eigenschaften sollen nach der aufgeheizten Debatte Vertrauen zurückgewinnen und im Bundestag eine breite Zustimmung ermöglichen. Ihre Laufbahn, die sowohl wissenschaftliche Arbeit als auch langjährige richterliche Erfahrung umfasst, macht sie zu einer sicheren Wahl.
Die SPD versteht Emmeneggers Nominierung als pragmatische Lösung. Die Reaktionen darauf sind geteilt: Teile der CDU/CSU zeigen sich erleichtert, während Grüne und Linke kritisieren, dass sie bei der Auswahl kaum einbezogen waren. Kritiker werfen der SPD vor, vor allem auf Stabilität und Konsens zu setzen und dabei mögliche progressive Impulse zu vernachlässigen. Es bleibt zu klären, ob Emmenegger für inhaltlichen Aufbruch steht oder lediglich für den dringend benötigten Kompromiss.
Die Wahl, die Ende September 2025 im Deutschen Bundestag stattfinden soll, ist deshalb mehr als nur ein Personalwechsel. Sie wird zum Test dafür, ob es der Politik gelingt, Konflikte transparent zu lösen und Vertrauen in die Institutionen zu stärken.
Nach Rückzug von Brosius-Gersdorf: SPD nominiert Sigrid Emmenegger für das Bundesverfassungsgericht
Nachdem Frauke Brosius-Gersdorf ihre Kandidatur als Richterin für das Bundesverfassungsgericht zurückgezogen hatte, stand die SPD unter Druck, rasch eine neue Lösung zu präsentieren. #PolitikDE
20.09.2025 09:18 — 👍 4 🔁 1 💬 0 📌 0
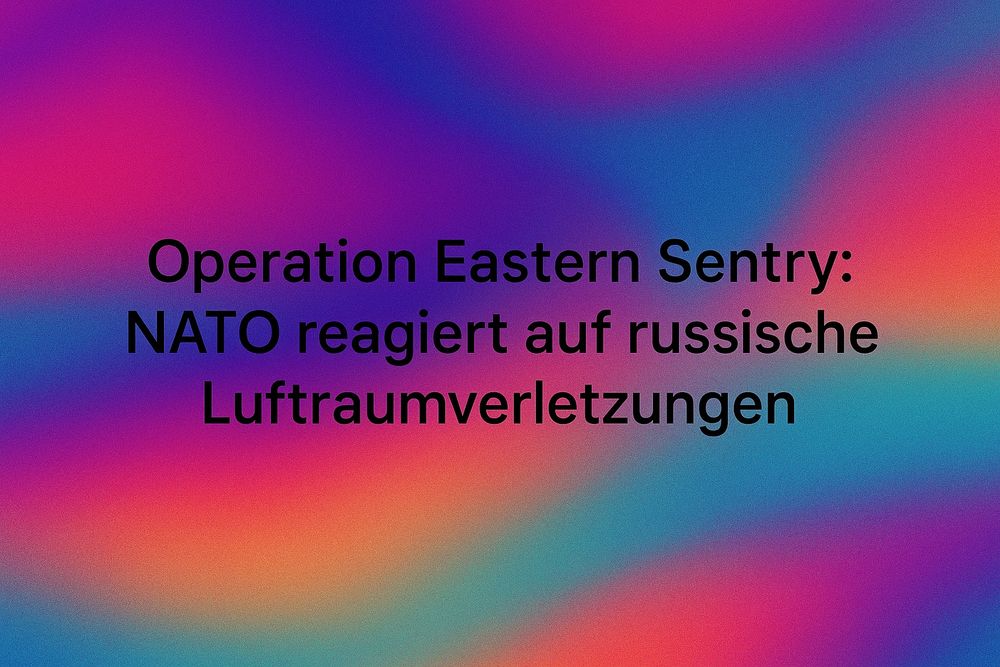
Polen reagierte sofort: Mehrere Drohnen wurden abgeschossen, Flughäfen stellten vorübergehend den Betrieb ein, und Trümmerteile stürzten auf polnischem Gebiet ab. In Warschau besteht kein Zweifel, dass es sich um eine gezielte Provokation handelt. Premierminister Donald Tusk sprach von einer eindeutigen Verletzung internationalen Rechts und forderte eine geschlossene Antwort der Allianz.
Die Antwort der NATO kam schnell: Am 12. September 2025 kündigte Generalsekretär Mark Rutte die Militäroperation Eastern Sentry an. Sie soll die östliche Flanke der NATO, von Polen bis ins Baltikum, stärken. Dafür werden Luftstreitkräfte, Marineschiffe und Bodentruppen aus mehreren Mitgliedstaaten eingesetzt, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Anders als bei festen Stationierungen setzt die NATO auf flexible, rotierende Kontingente. Damit will sie zeigen, dass sie jederzeit handlungsfähig und entschlossen ist.
Damit verfolgt die NATO zwei Ziele: Erstens macht sie deutlich, dass Luftraumverletzungen gegen ein Mitglied nicht akzeptiert werden. Zweitens zeigt sie, dass das Verteidigungsbündnis trotz politischer Spannungen geschlossen bleibt. Vor allem Polen und die baltischen Staaten hatten schon lange auf ein entschiedeneres Vorgehen gedrängt. Jetzt zeigt sich: Rote Linien sind nicht nur Worte, sondern werden im Ernstfall auch militärisch durchgesetzt. Für die NATO bedeutet das, dass jede Provokation das Risiko einer direkten Konfrontation mit Russland erhöht.
Noch ist unklar, ob die Drohnen absichtlich gesteuert wurden oder ob technische Fehler im Spiel waren. Doch selbst ein Unfall könnte eine Eskalation auslösen. Je mehr Truppen, Schiffe und Flugzeuge nahe der Grenze eingesetzt werden, desto größer wird die Gefahr von Zwischenfällen. Außerdem ist offen, ob Eastern Sentry nur ein vorübergehender Schritt ist oder den Beginn einer neuen Sicherheitsordnung einleitet, verbunden mit hohen Kosten für die Mitgliedstaaten.
Am 9. September 2025 drangen russische Drohnen in großer Zahl aus Richtung Belarus in den polnischen Luftraum ein. Dabei handelte es sich hauptsächlich um iranische Shahed-Drohnen, die Moskau massenhaft einsetzt. #NATO #Militäroperation #EasternSentry #Polen #Drohnenangriffe #Luftraumverletzungen
13.09.2025 22:28 — 👍 7 🔁 0 💬 0 📌 0

EU-Gericht erlaubt Klimasiegel für Atomkraft und Erdgas
Österreich, das seit 2022 gegen die Einstufung geklagt hatte, scheiterte mit dem Vorwurf des Greenwashings. Die Begründung: Die Kommission habe ihr Mandat nicht überschritten.
Nach Ansicht des Gerichts produziert Atomenergie nahezu emissionsfrei Strom und kann so Kohlekraftwerke ersetzen. Erdgas gilt als Brückentechnologie, wenn es Kohle ersetzt und mit modernster Technik betrieben wird. Spätestens 2035 muss es zudem auf erneuerbare oder CO₂-arme Alternativen umgestellt sein. Damit bleibt die Tür für Investitionen in beide Energieträger geöffnet, allerdings unter strengen Auflagen.
Während Frankreich, Polen und Bulgarien das Urteil als pragmatische Absicherung von Versorgungssicherheit begrüßen, spricht Wien von einem „schwarzen Tag fürs Klima“. Umweltverbände wie Greenpeace warnen, dass Milliarden in Gas- und Atomprojekte fließen könnten, anstatt den dringend nötigen Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben. Der Konflikt zwischen Klimaschutzanspruch und Energierealität spitzt sich damit weiter zu.
Das Urteil macht erneut die tiefen Gräben innerhalb der EU in der Energie- und Klimapolitik sichtbar. Frankreich betrachtet Kernkraft als Grundpfeiler seiner Klimastrategie, während Deutschland klar gegen Atomkraft positioniert ist. Österreichs Versuch, die Taxonomie zu kippen, ist gescheitert, doch Wien kann in den kommenden zwei Monaten beim Europäischen Gerichtshof Berufung einlegen.
Kurzfristig stärkt die Entscheidung die Investitionssicherheit in Gas- und Atomenergie. Langfristig wirft sie jedoch Fragen auf: Wird das „Klimasiegel“ die Energiewende ausbremsen? Oder verschafft es den nötigen Spielraum, um Kohle rasch zu ersetzen und Zeit für den Ausbau der Erneuerbaren zu gewinnen? Klar ist: Die EU balanciert auf einem schmalen Grat zwischen ökologischer Glaubwürdigkeit, ökonomischer Realität und geopolitischem Druck.
Am 10. September 2025 entschied das Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg über eine Richtungsfrage: Darf die EU-Kommission Atomkraft und Erdgas weiterhin als „klimafreundlich“ einstufen? Ja, urteilten die Richter, und bestätigten damit die umstrittene EU-Taxonomie. #Klimasiegel
13.09.2025 07:17 — 👍 6 🔁 0 💬 1 📌 0

Hinter diesen Täuschungen stehen organisierte Netzwerke, sogenannte Paper Mills, die massenweise gefälschte Studien produzieren. Auf den ersten Blick wirken sie seriös, doch in Wahrheit bestehen sie aus erfundenen Daten und geschönten Ergebnissen. Damit gerät das Fundament der Wissenschaft, die Suche nach Wahrheit, ins Wanken.
In vielen Ländern, darunter China und Indien, gilt nach wie vor das Prinzip „Publish or Perish“. Wer viele Artikel publiziert, erlangt Ansehen, Fördergelder und Karrierechancen. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeutet das enormen Druck: Ohne genügend Publikationen sinken die Chancen auf Stellen, Forschungsgelder und Anerkennung. Für Betrüger dagegen ist es ein lukratives Geschäftsmodell. Sie bieten „fertige Studien“ zum Kauf an. Jedes Jahr gelangen Schätzungen zufolge weltweit 10000 bis 20000 Paper-Mill-Publikationen in den Umlauf. Fachleute gehen von einer noch deutlich höheren Dunkelziffer aus.
Diese Betrugsnetzwerke funktionieren wie eine Industrie: Sie erfinden Daten, manipulieren Gutachten und sorgen mit gegenseitigen Zitierungen für den Anschein von Relevanz. Besonders betroffen sind sensible Bereiche wie Medizin, Biologie und Ingenieurwissenschaften, Fachgebiete, in denen falsche Ergebnisse direkte Folgen für Gesundheit, Technologie und Gesellschaft haben können. Selbst renommierte Fachzeitschriften sind nicht davor gefeit, gefälschte Studien zu veröffentlichen. Mit jedem gefälschten Artikel schwindet das Vertrauen in die Wissenschaft, und echte Erkenntnisse geraten in den Hintergrund.
Ehrliche Forscherinnen und Forscher arbeiten oft jahrelang an einer Studie. Betrugsnetzwerke dagegen liefern Ergebnisse im Akkord. Fake-Veröffentlichungen breiten sich dabei fast zehnmal schneller aus als legitime wissenschaftliche Arbeiten. Prüfmechanismen wie Peer Review oder KI-Erkennungssysteme stoßen jedoch schnell an ihre Grenzen, denn die Fälschungen werden immer raffinierter.
Am 17. August 2025 hat die Universität Illinois eine alarmierende Studie veröffentlicht: Immer mehr vermeintliche Forschungsarbeiten entpuppen sich als plumpe Fälschungen. #FakeScience #PaperMills #ScienceFraud #FaktenStattFakes #TrustScience #WahrheitZählt #RettetDieWissenschaft #EchteForschung
09.09.2025 21:45 — 👍 9 🔁 3 💬 0 📌 0
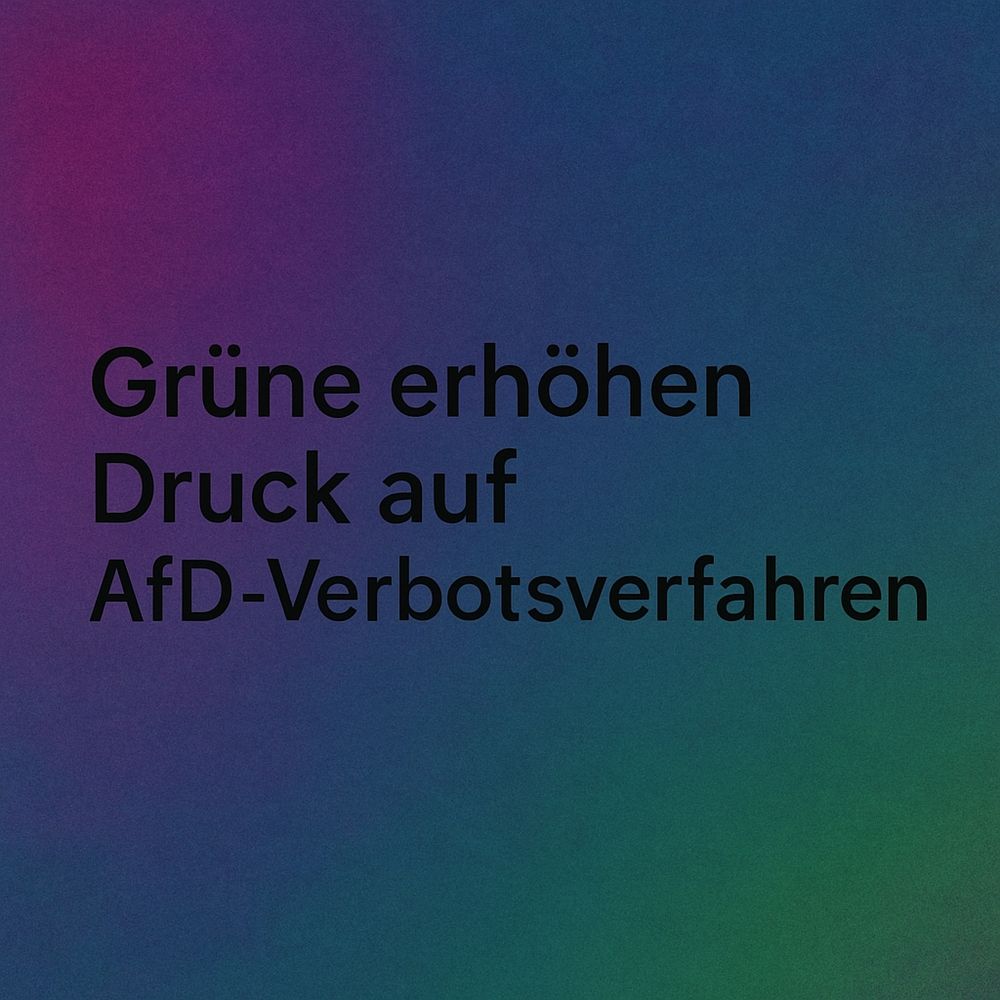
Was früher nur als Warnung galt, ist heute Realität: Die Demokratie steht unter Druck, und sie muss verteidigt werden.
Die Grünen machen deutlich, dass es kein Zögern mehr geben darf. Pegah Edalatian, politische Geschäftsführerin der Partei, sagt klar: „Es ist höchste Zeit, ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten, zum Schutz unserer Demokratie.“ Rückhalt kommt auch aus der Bundestagsfraktion: Britta Haßelmann und Katharina Dröge haben CDU/CSU (Union), SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) und Linke zu einem gemeinsamen Gespräch eingeladen. Ihre Botschaft ist unmissverständlich: Handeln, bevor es zu spät ist.
Vor allem die Union darf sich nicht länger hinter Ausreden verstecken. Die Sorge, ein Verbot könne der AfD nutzen, blockiert jede Entscheidung. Doch auch Untätigkeit hat Folgen, und stärkt am Ende genau die Kräfte, die die Demokratie aushöhlen wollen. Die Union muss endlich Stellung beziehen und Verantwortung übernehmen.
Ein Parteiverbot ist ein schwerer Schritt, und genau deshalb ist es richtig, dass am Ende das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Doch ohne den politischen Willen von Bundestag, Bundesregierung oder Bundesrat kann ein Verfahren gar nicht erst beginnen. Jetzt gilt es, diesen Willen zu zeigen. Demokratie bedeutet nicht, tatenlos zuzusehen, sondern entschlossen zu handeln.
Die Verteidigung der Demokratie erfordert Mut, Klarheit und Zusammenhalt. Es geht nicht um Parteitaktik, sondern um das Fundament des Staates. Die Einladung der Grünen, unterstützt von SPD und Linken, ist eine Chance, und zugleich ein Prüfstein für die Union. Wird sie Verantwortung übernehmen? Jede Verzögerung spielt den Falschen in die Hände.
Die Botschaft ist eindeutig: Es darf keine Ausreden mehr geben. Jetzt ist die Zeit, ein AfD-Verbotsverfahren einzuleiten.
Deutschland steht vor einer wichtigen Entscheidung. Die AfD (Alternative für Deutschland) ist längst keine Protestpartei mehr. Sie treibt Radikalisierung voran, will die Demokratie abschaffen und untergräbt gezielt das Vertrauen in staatliche Institutionen. #WehrhafteDemokratie #DieGrünen #AfDVerbot
06.09.2025 13:05 — 👍 42 🔁 12 💬 0 📌 0

Geliefert werden vier Konverter (Stromumwandler) für die Bornholm Energy Island, ein Kernprojekt für die europäische Energiewende. Diese „Energieinsel“ soll als zentraler Knotenpunkt für Offshore-Windstrom aus der Ostsee dienen.
Die dänische Insel Bornholm wird damit zur Schaltzentrale der grünen Energieversorgung. Von hier aus führen künftig Hochspannungs-Gleichstromleitungen nach Deutschland und auf die dänische Insel Seeland. Geplant ist die Übertragung von 2 Gigawatt grünem Strom nach Deutschland und weiteren 1,2 Gigawatt nach Dänemark. So entsteht ein Knotenpunkt, der beide Länder enger verbindet und zugleich Europas Versorgungssicherheit stärkt.
Der Auftrag umfasst weit mehr als Techniklieferungen: Siemens Energy übernimmt Design, Fertigung, Transport, Installation und Inbetriebnahme der Konverter. Abgeschlossen sein soll das Projekt bis Mitte der 2030er Jahre. Für Siemens Energy bedeutet der Auftrag nicht nur Umsätze in Milliardenhöhe, sondern auch eine Festigung seiner Position als einer der führenden Anbieter im internationalen Offshore-Geschäft.
Das Gesamtvolumen des Bornholm-Energy-Island-Projekts liegt bei rund sieben Milliarden Euro. Angesichts dieser Dimension greifen auch Politik und Europäische Union ein: Brüssel steuert 645 Millionen Euro Fördermittel bei, vor allem zur Entlastung der dänischen Seite. Zudem gewährt die deutsche Bundesregierung eine Haftungsgarantie für Stromausfälle. Ohne diese Absicherungen wäre das Projekt kaum realisierbar.
Der Milliardenvertrag ist damit mehr als ein Geschäft: Er markiert den Beginn einer neuen europäischen Energiearchitektur. Mit Bornholm als Stromdrehscheibe zeigt sich, wie stark die Energienetze von morgen miteinander verknüpft sein werden. Siemens Energy steht im Zentrum dieser Transformation, und die Ostsee wird zum Sinnbild für die Verbindung von Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wirtschaftlicher Stärke.
Siemens Energy sichert sich Milliardenauftrag für Ostsee-Projekt
Am 4. September 2025 wurde bekannt gegeben, dass Siemens Energy einen Auftrag über mehr als eine Milliarde Euro erhalten hat. #Energiewende #Klimaschutz #OffshoreWind #GreenEnergy #SiemensEnergy #BornholmEnergyIsland #OstseeProjekt
05.09.2025 20:27 — 👍 4 🔁 1 💬 0 📌 0

Goldpreis erreicht neues Rekordhoch von über 3500 US-Dollar
Am 2. September 2025 hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht. Eine Feinunze kostete zeitweise 3508,73 US-Dollar. Nach einem kurzen Rücksetzer stabilisierte sich der Kurs bei rund 3484 US-Dollar und übertraf damit das bisherige Allzeithoch vom April deutlich. Anleger sprechen von einem „Meilenstein auf dem Edelmetallmarkt“.
Mehrere Faktoren treiben den Preis: Vor allem die Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed Mitte September gibt Rückenwind. Da Gold keine laufenden Erträge abwirft, steigt seine Attraktivität, sobald die Renditen von Anleihen sinken. Zusätzlich schwächelt der US-Dollar, was das Edelmetall für internationale Käufer günstiger macht.
Auch anhaltende innenpolitische Spannungen in den USA verstärken die Verunsicherung internationaler Anleger. In solchen turbulenten Zeiten suchen internationale Investoren traditionell sichere Häfen, und Gold erfüllt diese Rolle seit Jahrhunderten.
Nicht nur Privatanleger, sondern auch institutionelle Investoren und Zentralbanken, insbesondere in China, kaufen kräftig Gold. Der weltgrößte Gold-ETF, der SPDR Gold Trust, verzeichnet derzeit viel neues Anlegerkapital. Diese hohe Nachfrage verleiht dem Goldmarkt zusätzliche Stabilität und trägt dazu bei, dass die Rally nicht nur kurzfristig anhält, sondern eine solide Grundlage für dauerhaftes Wachstum bildet.
Analysten rechnen mit weiteren Rekorden. Manche Experten halten noch in diesem Jahr einen Anstieg auf 3600 bis 3900 US-Dollar für möglich, mittelfristig sogar bis auf 4000 US-Dollar im Jahr 2026. Entscheidend wird sein, ob die erwartete Zinssenkung tatsächlich kommt und wie sich die geopolitischen Spannungen entwickeln. Klar ist schon jetzt: Gold bleibt das Investment für Sicherheit und glänzt derzeit heller denn je.
Am 2. September 2025 hat der Goldpreis ein neues Rekordhoch erreicht. Eine Feinunze kostete zeitweise 3508,73 US-Dollar. Nach einem kurzen Rücksetzer stabilisierte sich der Kurs bei rund 3484 US-Dollar und übertraf damit das bisherige Allzeithoch vom April deutlich. #Gold #Finanzmärkte #Wirtschaft
04.09.2025 18:24 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0

Mit 7 zu 4 Stimmen stellten die Richter klar, dass das von Trump herangezogene Notstandsgesetz International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) keine Grundlage für die Erhebung von Zöllen darstellt. Damit wird eine zentrale Säule seiner Wirtschaftspolitik juristisch infrage gestellt, ein herber Rückschlag für den Präsidenten, der seine „America First“-Agenda maßgeblich auf Strafzölle stützte.
Das Urteil betrifft insbesondere die pauschale Abgabe von 10 Prozent auf sämtliche Importe sowie Sonderzölle von bis zu 50 Prozent auf bestimmte Länder, darunter Madagaskar und Vietnam. Trump hatte diese Maßnahmen mit dem Kampf gegen den Drogenhandel und die Handelsdefizite gerechtfertigt. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht und stellte klar: Der Präsident darf sich nicht über die Kompetenzen des Kongresses hinwegsetzen. Unberührt bleiben jedoch branchenspezifische Zölle, etwa auf Stahl, Aluminium oder Autos.
Obwohl das Urteil eindeutig ausfiel, bleiben die Zölle bis Mitte Oktober 2025 in Kraft. Die Richter setzten ihre Entscheidung aus, um der Regierung Zeit für eine Berufung beim Supreme Court einzuräumen. Damit bleibt der Fall hochpolitisch und könnte zu einer Grundsatzentscheidung über die Grenzen präsidialer Macht in Handelspolitik und Notstandsrecht führen.
Donald Trump reagierte wie gewohnt mit scharfen Gegenangriffen. Auf seiner Plattform Truth Social erklärte er, „ALLE ZÖLLE SIND WEITERHIN IN KRAFT!“ und brandmarkte das Gerichtsurteil als „totale Katastrophe für unser Land“.
Das Urteil hat nicht nur juristische, sondern auch ökonomische Sprengkraft. Unternehmen könnten Gelder in Milliardenhöhe zurückfordern, ein Szenario, das den Staatshaushalt belastet und das Defizit weiter anschwellen lässt. Politisch setzt die Entscheidung ein klares Signal: Die Macht der Exekutive hat Grenzen. Der Supreme Court wird nun entscheiden müssen, ob Trump die Grenzen präsidialer Macht dauerhaft verschiebt oder ob die Gewaltenteilung auch im Handelskrieg standhält.
Am 29. August 2025 hat ein US-Berufungsgericht in Washington, D.C., den Großteil der von Donald Trump verhängten „Liberation-Day-Strafzölle“ gekippt. #USA #Strafzölle #Handelspolitik #USGericht #SupremeCourt #GlobalEconomy #TrumpZölle #IEEPA #Gerichtsurteil #JuristischeNiederlage #Ökonomie #Importe
31.08.2025 19:55 — 👍 19 🔁 2 💬 1 📌 0

Hinter dieser Normalität steckt ein hochkomplexes System: Fast 5600 Versorger betreiben ein 540000 Kilometer langes dezentrales Leitungsnetz mit einem jährlichen Verbrauch von rund fünf Billionen (5000 Milliarden) Litern Trinkwasser. Doch so stabil dieses Netz auch ist, es ist keineswegs unverwundbar. Ein großflächiger Ausfall der Wasserversorgung wäre ein Schock für die gesamte Gesellschaft.
Über Stromausfälle wird oft diskutiert, Wasserausfälle dagegen sind kaum im Bewusstsein. Dabei hängt die Versorgung direkt am Stromnetz. Ohne Energie laufen Pumpen und Aufbereitung nicht, es droht der sogenannte „Blue-out“. Schon nach 24 Stunden ohne Wasser treten erste Symptome auf: Durst, Kreislaufprobleme, Herzrasen. Nach wenigen Tagen wird die Lage lebensbedrohlich. Flaschenwasser und Tankwagen helfen nur kurzfristig, solange Logistik und Infrastruktur funktionieren.
Kleinere Störungen wie Rohrbrüche beheben die Wasserwerke meist selbst. Bei größeren Vorfällen, etwa bei Keimen im Trinkwasser, greifen Gesundheitsämter, Landratsämter und Feuerwehr ein. Für den Ernstfall existieren Notstromaggregate und Notbrunnen. Doch eine bundesweite Übersicht über Reserven fehlt, es ist unklar, wie gut Deutschland im Ernstfall reagieren könnte.
Der Bund hat über 5000 Notbrunnen und Trinkwassernotquellen eingerichtet. Gleichzeitig wächst der Druck durch die Klimakrise: längere Trockenperioden, sinkendes Grundwasser sowie steigender Verbrauch. Schon heute gelten etwa die Hälfte der Landkreise als „Wasserstress-Gebiet“, also Regionen, in denen mehr Wasser genutzt wird, als langfristig nachfließt. Fachverbände fordern deshalb klimaresiliente Strukturen: flexible Steuerung von Talsperren, Wasserampeln sowie strengere Verbrauchsbegrenzungen.
Die Analyse vom 29. August 2025 zeigt: Deutschlands Wasserversorgung ist stark, aber verletzlich. Solange Strom fließt und das Klima stabil bleibt, funktioniert das System nahezu perfekt.
Für uns in Deutschland ist Trinkwasser selbstverständlich. Im Schnitt verbrauchen wir täglich rund 126 Liter pro Kopf, für Duschen, Kochen, Waschen oder Trinken. #WasserSicherheit #Krisenvorsorge #BlueOut #Trinkwasser #Notfallversorgung #Klimakrise #Wasserstress #Zukunftsvorsorge #Lebensgrundlage
31.08.2025 00:12 — 👍 18 🔁 1 💬 4 📌 0