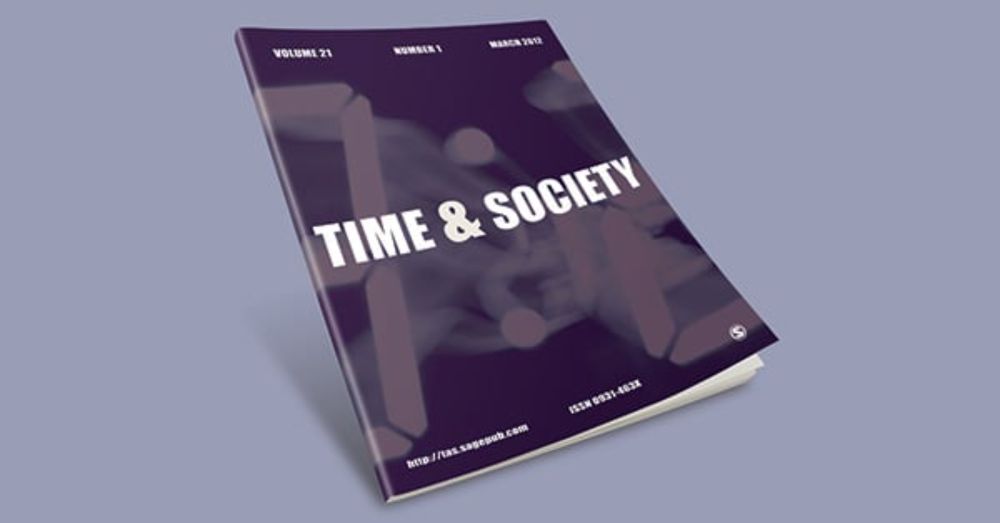Mein Fazit #dgs2025 : Transitionen sind messy; alles muss durch eine vollgestellte Gesellschaft. Und da ist über Leute noch nichts gesagt. Lohnt es sich da noch zu fragen, wer wen von was (oder auch vom Gegenteil) überzeugen will? Wir müssen Begriffsschneisen durch das Chaos schlagen. Wer sonst?
26.09.2025 15:42 — 👍 8 🔁 2 💬 0 📌 0
Obgleich ich etwas befangen bin: Niemand kann bezweifeln, welch Erfolg @soziopolis.bsky.social ist, wieviel Arbeit die Kolleg:innen investieren und welche Bedeutung eine solche Plattform für die Soziologie in Deutschland noch haben könnte. Hoffentlich geht es nach 2028 weiter. Glückwunsch!
26.09.2025 12:19 — 👍 36 🔁 9 💬 0 📌 0
Wir freuen uns auf alle, die in Zukunft den Weg nach Mainz finden werden. Lasst uns gemeinsam über die „Zukünfte der Gesellschaft“ diskutieren! #dgs2026
26.09.2025 10:46 — 👍 18 🔁 3 💬 0 📌 0

Gewinne, Gewinne, Gewinne! 🎉
Wir gratulieren Lukas Pfäffle (l) und Conrad Lluis (r) sowie Martin Repohl (m) herzlich zum Nachwuchspreis 2024 respektive 2025 der Theoriesektion!
#dgs2025
25.09.2025 17:03 — 👍 19 🔁 5 💬 0 📌 0
Los geht’s mit der thematischen Einführung von Leo Schwarz (Jena). Der Raum ist bis auf den letzten Platz gefüllt, großartig!
Nicht vergessen: Im Anschluss Mitgliederversammlung der Theoriesektion und Verleihung der Nachwuchspreise! #dgs2025
25.09.2025 12:26 — 👍 9 🔁 3 💬 0 📌 0
Interessant: Podium mit 2 Nicht-Profs mit systemtheoretischem Sound füllt den großen Hörsaal. Problemsensible (Post-)Luhmannianische Diagnosen des Politischen finden Resonanz. Nimmt man noch das gestrige AmC (Reckwitz) mit dazu, kann man sagen: Revival der Gesellschaftstheorie #dgs2025
24.09.2025 10:57 — 👍 19 🔁 4 💬 0 📌 0
@heikedelitz.bsky.social Betrachtet man Gesellschaft als zu integriert, wenn man mit Luhmann funktionalistisch Problemlösungen sucht & findet? Übersieht man das Konflikthafte? @nilskumkar.bsky.social: Nö. (Lange Antwort: Problemlösungen haben Nebenfolgen, können gar katastrophal sein).
24.09.2025 10:45 — 👍 5 🔁 1 💬 1 📌 0
Klassiker. Hashtag vergessen #dgs2025
24.09.2025 10:21 — 👍 4 🔁 1 💬 1 📌 0

Noch gerade so einen Platz erhascht bei der Diskussion mit @nilskumkar.bsky.social und @koljamoeller.bsky.social Dafür erste Reihe.
24.09.2025 10:04 — 👍 14 🔁 3 💬 1 📌 1
Hach. Auf dem #dgs2025 fühlt sich Bluesky fast nach Twitter an. Fast. Nicht ganz. Nicht wirklich. #verlust
23.09.2025 21:45 — 👍 6 🔁 0 💬 0 📌 0
Ich freue mich auf meine gemeinsam mit @saschadickel.bsky.social organisierte Ad-hoc-Gruppe "Akteur ohne Mensch" zum Thema nichthumane Agency. Morgen um 9:00 in LK 061 #DGSKongress2025
23.09.2025 19:18 — 👍 13 🔁 4 💬 0 📌 0
Der Beamte in mir sagt: Großes Lob an alle, die dafür sorgen, dass Panels pünktlich schließen und keine weiteren Fragen zulassen. #dgs2025
23.09.2025 16:33 — 👍 5 🔁 2 💬 0 📌 0

@seyfert.bsky.social @armbruster.bsky.social @gretawagner.bsky.social und Ute Tellmann diskutieren den Verlust von Reckwitz. Voller Hörsaal, treffende und produktive Kritiken. Wie kann und wie soll die Moderne mit Verlust umgehen? Auch Thema: Was kann Gesellschaftstheorie heute leisten? #dgs2025
23.09.2025 15:55 — 👍 8 🔁 1 💬 1 📌 0
Vielleicht nicht immer, aber zumindest hier :-) Danke für den Snapshot, @technikreflex.smartcity.social.ap.brid.gy #dgs2025
23.09.2025 15:33 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0
DGS Kongress 2025 - ConfTool Pro - BrowseSessions
Morgen um 12:00 Uhr dürfen @koljamoeller.bsky.social und ich unsere Bücher auf einem Author-meets-Critics mit @heikedelitz.bsky.social, @larsgertenbach.bsky.social und Tanja Bogusz diskutieren. Kommt vorbei, das wird super!
www.conftool.com/dgskongress2...
23.09.2025 09:36 — 👍 9 🔁 2 💬 1 📌 0

So sieht das aus #dgs2025
23.09.2025 09:32 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0

@afolkers.bsky.social kommt seinen Pflichten nach. Hier werden nicht (nur) fancy STS und new materialisms geboten. Auch Marx und die Kritische Theorie werden verfügbar gemacht. #residualereifikation als erweiterte Verdinglichungstheorie
23.09.2025 09:30 — 👍 4 🔁 1 💬 1 📌 1
Insgesamt ein wirklich einsichtsreiches Panel für mich. Interessante Querverbindungen. Abgehängtes Land trifft Singularität trifft rechte Zukunftsnarrative trifft fossile Moderne. #dgs2025 Rasante, zähe Transitionen
23.09.2025 09:18 — 👍 7 🔁 0 💬 0 📌 0

Instruktiver Vortrag von @saschadickel.bsky.social auf dem #dgs2025 zu den Zukünften von Artificial Super Intelligence und den Dystopien der kommenden Singularität, obgleich er in den Nebenraum übertragen wurde!
23.09.2025 08:15 — 👍 5 🔁 1 💬 0 📌 1

Toller Eröffnungsvortrag von der @dgsoziologie.bsky.social Vorsitzenden Monika Wohlrab-Sahr. Gleich ein Einstieg mit Appell für kollegiales und integratives Verhalten in der DGS (Stichwort Akademie).
Anschließend klare Worte zu den Herausforderungen der Zeit – und der Soziologie.
#DGS2025
22.09.2025 16:01 — 👍 20 🔁 2 💬 3 📌 1
Ein Jammer, dass ich mir das nicht anhören / ansehen kann…
22.09.2025 11:23 — 👍 0 🔁 0 💬 1 📌 0
So. Jetzt geht es zum #dgs2025 Freu mich!
22.09.2025 11:22 — 👍 3 🔁 0 💬 0 📌 0
Wow. Zauberhaft.
22.09.2025 06:31 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
ja. dies.
22.09.2025 06:30 — 👍 1 🔁 0 💬 0 📌 0

Wer hat morgen Lust auf ein Gespräch über KI und Kommunikation in Mainz? Bitte hier entlang: www.institutfrancais.de/de/mainz/eve...
08.09.2025 14:57 — 👍 2 🔁 0 💬 0 📌 0
Plausible Futures emerge when words, images, and things align.
🔍 Understanding emerging technologies requires analyzing how they are communicated as futures—or dismissed as fiction.
23.07.2025 06:01 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
And yet: Visualizations 🎥 and prototypes 🔧 matter deeply.
They make imagined worlds tangible.
They condense complexity and stabilize expectations.
Together with language, they generate a crucial effect: evidence.
They suggest: this might actually happen.
23.07.2025 06:01 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
STS often emphasizes materiality, but:
👉 Only language can temporalize an unreality—one can explicitly say: this does not exist yet, but might (or should).
Without words, artifacts remain present objects. They don’t point to the future on their own.
23.07.2025 06:01 — 👍 1 🔁 0 💬 1 📌 0
Technik. Für Menschen. Gestalten.
free software, partizipative Technikgestaltung, ValueSensitiveDesign.
Aktiver auf Mastodon: https://smartcity.social/@technikreflex
Mirror: https://bsky.app/profile/technikreflex.bsky.social
Redakteurin @soziopolis.bsky.social | Co-Host @mittelweg36.bsky.social – Der Podcast | freelance critic
Sociologist | Postdoc @uni-konstanz.de (Germany) https://tinyurl.com/3e4edpbc
Project "Postmigration": https://tinyurl.com/yjeevh22
I am an academic ✒ on 🚯🚆🐮💾. #sts #sociology #ecology #waste #energy
Plus, Fujifilm #photography
I post POSSE style: Publish on your Own Site, Syndicate Elsewhere. Many things Asia, VN.
https://social.tchncs.de/@stefanlaser
https://stefanlaser.net
Der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft.
Von und mit Jan Groos.
www.futurehistories.today
English: http://futurehistories-international.com
Soziologe | Körpersoziologie @ JGU Mainz | SFB 1482 Humandifferenzierung | Social Media Boomer™
Sociologist, researching work, ecology and digitalization at KU Leuven and Institute for Social Research Frankfurt.
simschaupp.de
Sektion Soziologische Theorie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie (DGS)
Sociological Theory Section in the German Sociological Association (DGS)
Skeeting on behalf of the board: @DWitte.bsky.social
Sociologist, working mostly on social theory, qualitative methods, protest, critique, and their discontents.
http://www.koljamoeller.com
Constitutionalism/Political Theory/Social Philosophy
@tu-dresden
Chronically Online Media Sociologist
Wrote my dissertation about VRChat
felix.krell@zu.de
Sociology of the Climate Crisis
Mercator Chair on the social dynamics of ecological transformation (@gklimawende.bsky.social)
Humanities Centre 'Futures of Sustainability' at University of Hamburg (@fos-uhh.bsky.social)
Views here are my own.
Sociologist at Uni Hamburg │ PhD project on climate science’s theorizing of society │ science studies, historical sociology, world society theory
sociologist - critical theorist - STSist. Currently at @ifsfrankfurt.bsky.social. Columbia University. Working on climate, capital, fossil modernity and more: andreasfolkers.eu
Bücher: 1977. Eine kurze Geschichte der Gegenwart (Suhrkamp 2021); Michel Foucault zur Einführung (Junius, 8. Aufl. 2023); The Big City. A Visual Anthology (Scheidegger&Spiess, März 2026). web: https://philippsarasin.ch
#staywithUkraine
Political Theorist @ifpolms.bsky.social
Editor @theorieblog.bsky.social
https://www.uni-muenster.de/IfPol/willems/personen/wm/tobias_albrecht.html
Pixelschieber, Inhaber/Kampfkunstlehrer der Stahlakademie, Vokalist und Komponist bei DTORN, Tattoo-Artist und ganz allgemein Nerd und Chaot. Mag […]
🌉 bridged from https://troet.cafe/@Nachtschattenspender on the fediverse by https://fed.brid.gy/
Sociologist interested in neighborhood change, housing, gentrification & digitalization | Professor for Human-Context Interaction @THWS | www.janueblacker.com